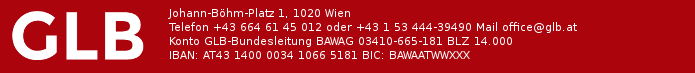Qualität statt Kostensenkung
- Donnerstag, 3. Juli 2014 @ 12:05

 Leo Furtlehner zur aktuellen Standortdebatte
Leo Furtlehner zur aktuellen StandortdebatteAusgelöst wurde die Debatte durch die Androhung der Top-Manager Eder (Voest), Treichl (Erste Bank) und Schaller (Raiffeisen Landesbank OÖ), die Standorte ihrer Unternehmen ins Ausland zu verlagern. Ziel dieser Ansagen war freilich weniger die Abwanderung, als vielmehr den Druck auf Löhne und Sozialleistungen zu erhöhen, die Arbeitszeit noch weiter auf Kosten der Beschäftigten zu flexibilisieren, Steuern und Abgaben zu reduzieren, die Energiekosten zu senken und Umweltstandards in Frage zu stellen. Vorteile im neoliberal globalisierten Wettbewerb sollen, so die unausgesprochene Logik, auf Kosten der Lohnabhängigen erzielt werden. Das Ziel liegt auf der Hand: Der Profit der Konzerne und Banken soll gesteigert werden um die Rendite-Erwartungen der Shareholder zufrieden zu stellen.
Willfährige Politik
Für die etablierte Politik waren die Sprüche von Eder, Treichl und Schaller jedenfalls Anlass in gehörige Hektik zu verfallen. Unisono erklärten Spitzenpolitiker von schwarz und rot, aber auch jene anderer Couleur, alles zu tun, um die Standorte zu sichern. Schließlich weiß das Kapital, wozu es sein hochbezahltes Personal hat. Vor allem aber ist die Debatte ein Anlass für einen Rückblick über die Veränderungen seit Ende der 1980er Jahre.
Der Konflikt um den Verkauf der Mehrheitsanteile der Linzer VAI vom deutschen Siemens-Konzern an den japanischen Konzern Mitsubishi hat einmal mehr verdeutlicht, wohin Zerschlagung und Privatisierung der verstaatlichten Industrie geführt haben. Die damals insbesondere von SPÖ und ÖGB als Schwarzmalerei abgetane Kritik des GLB hat sich leider voll und ganz bestätigt, daher jetzt der Katzenjammer.
Mit der Privatisierung der Verstaatlichten als einstigem Kernstück einer eigenständigen österreichischen Wirtschaftspolitik wurden wichtige Bereiche zum Spielball multinationaler Konzerne und der Aktionär_innen, wobei das Wechselspiel von Übernahmen und Weiterverkauf von Profitinteressen bestimmt wird.
Hohle Appelle
Entsprechend hilflos sind die hohlen Appelle der Politik Standorte zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Denn wer öffentliches Eigentum privaten Profiteuren ausliefert, hat logischerweise dann auch nichts mehr mitzureden und kann höchstens Bittgänge zu den vom Privatkapital eingesetzten Geschäftsführern unternehmen. Und deren Zusagen haben erfahrungsgemäß nur eine bescheidene Gültigkeit.
Gescheitert sind auch die vor allem von der SPÖ als maßgeblich Verantwortliche für den Ausverkauf propagierten Bestrebungen, durch heimische Kernaktionäre oder Mitarbeiterbeteiligungen zum Schutz von Standorten oder Arbeitsplätzen beizutragen. Ähnlich plump sind die Bestrebungen der SPÖ als Beschwichtigung ihres schlechten politischen Gewissens bei der Privatisierung zu bewerten, jetzt durch einen Industriefonds „gemeinsam mit Mitarbeiterbeteiligungen und befreundeten langfristigen Investoren“ durch Sperrminoritäten von 25 Prozent wieder Einfluss auf privatisierte Unternehmen zu gewinnen.
Angesichts der klammen Finanzlage von Bund, Ländern und Gemeinden müssten solche Beteiligungen letztlich wieder die Lohnabhängigen, sei es über ihre Steuern, über höhere Tarife und Gebühren oder Privatisierungen in anderen Sektoren, finanzieren. Wenn schon staatliches Eigentum als wichtig erkannt wird, warum dann nicht gleich Enteignung zugunsten der wirklichen Produzent_innen?
Erfolgsgeschichte – für wen?
Wenn jetzt die Arbeiterkammer für die „Stärkung der Erfolgsfaktoren“ die „Entwicklung qualitativ hochwertiger Strukturen und Fähigkeiten“ und eine „Abkehr vom ruinösen Standortwettbewerb in Europa“ verlangt, wird verdrängt, dass all dies unter kapitalistischen Bedingungen nur beschränkt möglich ist. Die dazu ins Treffen geführte positive Entwicklung der Industrieproduktion in Österreich war nämlich unterm Strich nur für die Kapitalbesitzer eine Erfolgsgeschichte. Nicht aber für die Lohnabhängigen, wie etwa das Sinken der Lohnquote oder die Vermögenskonzentration bei den rund 80.000 Millionär_innen beweist.
Die von den überbezahlten Topmanagern im Auftrag von Oligarchen oder Multis zur Untermauerung ihrer Forderungen ins Treffen geführten Standortrankings sind nichts anderes als eine bezahlte Auftragsarbeit zur Manipulation der öffentlichen Meinung. Die Absurdität solcher Rankings wird deutlich, wenn etwa das World Economic Forum die „Kosten von Gewalt und Verbrechen für Unternehmen“ in Österreich höher als in Ruanda und Armenien ausweist.
Völlig unter den Tisch fällt bei solchen „Argumenten“, dass die Wirtschaft den Menschen dienen soll und nicht umgekehrt. Eine Standortpolitik, welche die Arbeitskraft aussaugt, die Ressourcen plündert, die Umwelt schädigt, massenhaft Armut produziert, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zerstört, die Demokratie zugunsten autoritärer „Lösungen“ demontiert und die Menschen zu Konsumidioten degradiert hat ihren Zweck eindeutig verfehlt. Daher muss Qualität vor Kostensenkung stehen, wie etwa das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) feststellt, alles andere führt in die Irre.
Leo Furtlehner ist verantwortlicher Redakteur der „Arbeit“