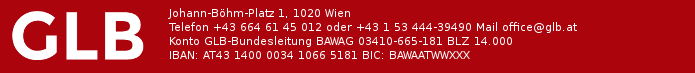Quo vadis Gesundheit & Sozial?
- Montag, 25. Februar 2019 @ 08:00


Geschätzte 17 bis 20 Prozent unter dem österreichischen Durchschnitt liegen die Gehälter im privaten und kirchlichen Gesundheits- und Sozialbereich. Das Gehalt stellt meist die Höchstlatte dar. Überzahlungen wie bei den Metallern üblich, kommen nur selten vor.
Ganz im Gegenteil – die Zuordnung in die der Ausbildung entsprechenden Verwendungsgruppe muss oft erst hart erstritten werden. Auch unbezahlte Arbeit daheim ist durchaus üblich, weil Vorbereitungs- und Dokumentationszeiten nicht mehr ausreichen. Eine Diensteinteilung auf zwei bis drei Blöcke täglich sind an der Tagesordnung, ebenso Überstunden oder kurzfristige Diensteinteilungen.
Gleichzeitig wird immer mehr auf Teilzeitarbeit gesetzt. Diese führt zu einem niedrigeren Stundenlohn und ist häufig nicht freiwillig. Andrerseits ist die Betreuungsarbeit oftmals durch gestiegene Klientenzahlen dermaßen anstrengend, dass viele Beschäftigte gesundheitsbedingt gar nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen oder können, um nicht völlig erschlagen und fix und fertig aus dem Dienst zu gehen.
Häufig werden dann geplante freie Zeiten auch noch durch kurzfristiges Einspringen für erkrankte KollegInnen zunichte gemacht. Viele Beschäftigte nehmen Lohneinbußen durch Teilzeitarbeit bewusst in Kauf, um nicht ins Burnout zu stürzen oder die Qualität der Betreuungsarbeit verschlechtern zu müssen.
Der Gesundheits- und Sozialbereich ist eine klassische Frauenbranche. Mehr als 80 Prozent der Beschäftigten sind weiblich. Und diese sind flexibel bis zum geht nicht mehr. Sie arbeiten im Turnus- und Radldienst, haben Wochenendeinsätze und sind oft auf Abruf arbeitsbereit. All dies wird nicht honoriert. Die Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn ist daher nicht überzogen. Auch um die Gehaltsschere gegenüber den männerdominierten Branchen zu verringern.
Ebenso die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung. Egal ob es die Einführung einer 35- Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich ist oder die Gewährung von mehr Urlaub oder zusätzlichen freien Tagen – Ziel ist, damit nicht nur einen Ausgleich zum niedrigen Lohnschema zu schaffen, sondern auch die Gesundheits- und Sozialberufe attraktiver zu machen. Schwere psychische Arbeit erfordert nun mal mehr Erholungszeit.
Es nützt in der Pflege nichts, dass mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden sollen, wenn diese nicht durch motivierte Menschen belegt werden bzw. ausgebildete BerufseinsteigerInnen bereits nach wenigen Jahren diesen Job wieder verlassen: Weil die Arbeitszeiten unattraktiv sind und gesundheitliche Probleme mit Rücken und Wirbelsäule Standard sind.
Weil es keine Wertschätzung durch Vorgesetzte oder schon gar nicht durch die Gesellschaft gibt und weil das Gehalt kaum zum Leben reicht und weil die Arbeit physisch und psychisch krank macht. Der Personalmangel besonders im Bereich Pflege und mobile Dienste ist schon jetzt eklatant und erfordert daher Unmengen an Mehrleistungs- und Überstunden und allerhöchste Flexibilität bei der Dienstplaneinteilung vom bestehenden Personal.
Die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialbereich haben keine Lust mehr auf Selbstausbeutung. Denn die Folgen dieser miesen Arbeitsbedingungen sind verheerend: Lange Krankenstände, Teilzeitarbeit mit Lohn am Existenzminimum oft in mehreren Beschäftigungsverhältnissen nebeneinander und im Endeffekt eine so mickrige Pension, die durch Beiträge aus der Mindestsicherung dann aufgestockt werden muss. Soll so die Zukunft der Menschen aussehen, die sich von Berufs wegen für andere Menschen einsetzen?
Ein gesellschaftspolitisches Umdenken ist unter der schwarz-blauen Regierung wohl eher unrealistisch. Vielmehr sollte vorgerechnet werden, welchen sozialen Profit die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialbereich erwirtschaften. Fakt ist, dass sie es sind, die der Wirtschaft den Rücken freihalten. Es rechnet sich allemal, Geld in die Betreuung für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Beeinträchtigung, für Pflegebedürftige, für Schwächere und Ärmere einzusetzen. Denn ein sozialer Mehrwert kommt zurück in eine lebenswerte Gesellschaft. Fraglich ist, ob man diese Gesellschaft so noch will.
Wie immer die (bei Redaktionsschluss noch im Gange befindlichen) Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft, Caritas oder Diakonie im Winter 2019 ausgegangen sind, klar ist, auch im kommenden Jahr wird wieder verhandelt. Und vermutlich wird es wieder zu Protestaktionen, vielleicht auch Streiks kommen, Geschäftsführer werden jammern, dass sie kein Geld von Bund, Ländern und Gemeinden bekommen, Gewerkschaften werden sozialpartnerschaftlich bemüht sein, empörte und fordernde Beschäftigte einzubremsen, irgendwann wird halt irgendwas unterschrieben und a Ruh` ist die nächsten Monate.
Kenn ich mittlerweile zur Genüge. Aber wohin sich der Gesundheits- und Sozialbereich wirklich entwickeln wird, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Eine Billiglohnbranche sind wir schon.
Heike Fischer ist Diplompädagogin und Betriebsratsvorsitzende im Diakonie Zentrum Spattstraße und GLB-Landesvorsitzende in OÖ