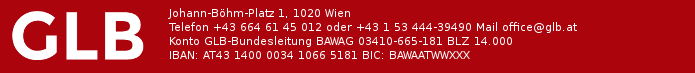Niedriglohnsektor mit gesetzlichem Mindestlohn bekämpfen
- Mittwoch, 25. April 2018 @ 10:42
 Die neue Studie der Arbeiterkammer OÖ über Niedriglöhne in Österreich ist für die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) einmal mehr Anlass für die Bekräftigung der Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn, stellt GLB-Bundesvorsitzender Josef Stingl fest. 2006 verdienten 24 Prozent der Beschäftigten weniger als 1.700 Euro brutto bei Vollzeitarbeit, 2016 waren es zwölf Prozent. Analog sank die Zahl der Beschäftigten die weniger als 1.500 Euro brutto für Vollzeitarbeit verdienten von 15 auf sechs Prozent. Der Vergleich blendet allerdings aus, dass die 1.700 bzw. 15.00 Euro von heute weit weniger wert sind als zehn Jahre zuvor. Bei Zugrundelegung einer Inflation laut Statistik Austria von rund 21 Prozent im Zeitraum 2007-2016 hätten für 2006 nämlich die Werte von 1.326 bzw. 1.170 Euro zugrunde gelegt werden müssen, wäre also der Rückgang der Niedriglohngruppen weitaus geringer, was den „lohnpolitischen Erfolg“ der Gewerkschaften relativiert.
Die neue Studie der Arbeiterkammer OÖ über Niedriglöhne in Österreich ist für die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) einmal mehr Anlass für die Bekräftigung der Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn, stellt GLB-Bundesvorsitzender Josef Stingl fest. 2006 verdienten 24 Prozent der Beschäftigten weniger als 1.700 Euro brutto bei Vollzeitarbeit, 2016 waren es zwölf Prozent. Analog sank die Zahl der Beschäftigten die weniger als 1.500 Euro brutto für Vollzeitarbeit verdienten von 15 auf sechs Prozent. Der Vergleich blendet allerdings aus, dass die 1.700 bzw. 15.00 Euro von heute weit weniger wert sind als zehn Jahre zuvor. Bei Zugrundelegung einer Inflation laut Statistik Austria von rund 21 Prozent im Zeitraum 2007-2016 hätten für 2006 nämlich die Werte von 1.326 bzw. 1.170 Euro zugrunde gelegt werden müssen, wäre also der Rückgang der Niedriglohngruppen weitaus geringer, was den „lohnpolitischen Erfolg“ der Gewerkschaften relativiert.Laut der AK-Studie verdienten 2016 bundesweit immer noch 215.000 (2006: 480.000) ganzjährig in Vollzeit Beschäftigte weniger als 1.700 Euro brutto (1.324 Euro netto). Davon waren 121.300 (2006: 300.000) die sogar weniger als 1.500 Euro brutto (1.197 Euro netto) verdienten. Da allerdings nur etwa die Hälfte der Beschäftigten einen ganzjährigen Vollzeitjob hat und diese Prekarisierung in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen hat muss auch die Arbeiterkammer einräumen, dass 2016 deutlich mehr als 400.000 Beschäftigte niedrigentlohnt waren. Betroffen sind vor allem die Gastronomie, Reinigung, Leiharbeit und der Handel.
Besonders betroffen vom Niedriglohnsektor sind Frauen: Während 2016 sieben Prozent (2006: 15 Prozent) der Männer weniger als 1.700 Euro bei Vollzeitarbeit verdienten, waren es bei den Frauen 17 Prozent (2006: 39 Prozent), analog verdienten vier Prozent (2006: acht Prozent) der Männer weniger als 1.500 Euro, hingegen neun Prozent (2006: 28 Prozent) der Frauen.
Auf der Kehrseite verdienten 2016 laut Statistik Austria 221 Personen (davon nur zehn Frauen) mehr als eine Million Euro brutto im Jahr, rund 70.000 Personen bzw. 14 Prozent (2006: sieben Prozent) der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten mehr als 70.000 Euro, was einem Monatseinkommen von brutto 5.830 Euro 14mal entspricht. Auch dabei ein eindeutiges Gefälle beim Geschlecht, nämlich 16 Prozent der Männer, aber nur acht Prozent der Frauen.
Nach wie vor lehnt der ÖGB einen gesetzlichen Mindestlohn als Eingriff in die lohnpolitische Kompetenz der Gewerkschaften und die Gefahr, dass ein Mindestlohn von der Willkür des Parlaments abhängen würde, ab. In Deutschland, wo 2015 ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wurde, hält dies freilich die Gewerkschaften in keiner Weise davon ab offensive Lohnkämpfe zu führen. Und mittlerweile gibt es bereits in 22 der noch 28 EU-Mitgliedsländer einen gesetzlichen Mindestlohn.
„Natürlich ist es positiv zu bewerten, dass in Österreich 98 Prozent der Beschäftigten einem Kollektivvertrag unterliegen. Jedoch kann angesichts der von der Arbeiterkammer laufend veröffentlichten Studien über die Reallohnentwicklung im Langzeitvergleich nicht behauptet werden, dass bei den KV-Abschlüssen optimale Ergebnisse erreicht worden sind. Dafür sind sozialpartnerschaftliche Packeleien hinter den Kulissen und die Verhinderung von Lohnkämpfen wie zuletzt in der Sozialwirtschaft verantwortlich“, so Stingl.
Der Verweis auf das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz gegen teilweise kriminelle Praktiken von Unternehmen – vor allem durch Weitergabe von Aufträgen an dubiose Subunternehmen – zeigt auch, dass dieses oft ein zahnloser Tiger ist. Statt Unternehmen, die Beschäftigte nicht anmelden, ihnen zustehende Löhne nicht entsprechend auszahlen oder Sozialabgaben und Steuern nicht abführen, grundsätzlich von öffentlichen Aufträgen auszuschließen und ihnen Konzessionen bzw. Gewerbeberechtigungen zu entziehen plant bekanntlich die schwarz-blaue Regierung sogar weitere Erleichterungen durch Angriffe auf das Kulminationsprinzip und Erleichterungen bei Strafen.