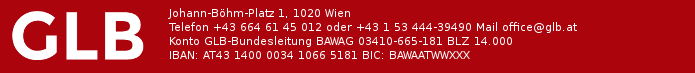Ganz schön vielschichtig
- Mittwoch, 19. April 2017 @ 08:00


Zum sprachlichen Arsenal der rechten Hetze gehört es auch, systematisch Ängste vor – meist islamischen – Parallelgesellschaften zu erzeugen. Dass es solche Strukturen traditionell im migrantischen Milieu gibt, ist aber nicht neu. Wer hat noch nicht etwa von China-Town oder Little-Italy in US-Großstädten gehört, zumindest in diversen TV-Serien. Auch in Österreich – historischen Fakten zufolge auch ein Einwanderungsland – gibt es solche Milieus.
Zeitgemäß als Communities bekannt, finden sich aus sprachlichen und kulturellen Gemeinsamkeiten zuwandernde Menschen zu Solidarität und Selbsthilfe zusammen. Das muss kein Hindernis, kann sogar eine Bereicherung für die vielfach geforderte Integration sein. Zur wirklichen Parallelgesellschaft wird das hingegen, wenn die vielgepriesene Integration von der „Mehrheitsgesellschaft“ verunmöglicht wird.
Und freilich gibt es – insbesondere im fundamentalistisch-islamischen Milieu – Erscheinungsformen, die sich in bewusster Abgrenzung zum Einwanderungsland verstehen und rückständige Einstellungen pflegen, die einer Integration und einem gedeihlichen Nebeneinander hinderlich sind. Die Auseinandersetzung damit ist Aufgabe einer sinnvollen Migrations- und Integrationspolitik.
Aber Parallelgesellschaften sind kein Privileg der Herausbildung ethnisch-homogener Netzwerke, die sich von der „Mehrheitsgesellschaft“ abschotten. Das trifft vor allem für jene zu, die diesen Kampfbegriff als Teil ihrer Politik von Hass und Hetze benutzen. Um auf die „Erfinder“ zurückzukommen – was sonst als Parallelgesellschaften sind etwa die deutschnationalen Burschenschaften. Diese stellen maßgeblich die Kader der FPÖ, pflegen als strenger Männerverein antiquierte Bräuche wie Kneipe als Umschreibung für hohen Bierkonsum bis Mensur, deren Ergebnis der Schmiss ist. Vom ganzen ideologischen streng deutschnationalen Brimborium, burschenschaftlichen Brauchtum und elitärem Dünkel einmal ganz abgesehen.
Szenenwechsel: Der tägliche Blick in die „Seitenblicke“ von ORF und Boulevardmedien zeigt uns eine weitere Parallelgesellschaft. Nämlich jene der „oberen zehntausend“, die immer unter sich bleibend von einem Event zum anderen zieht, sich gegenseitig lobhudelt und als Draufgabe zum Spitzeneinkommen kostenfrei das Buffet plündert. Dass dabei die Beziehung derart faszierender Politiker_innen zum gewöhnlichen Volk verloren geht, braucht nicht zu verwundern.
„Gutmensch“ ist nicht gut gemeint, sondern ein rechtsextremer Kampfbegriff zur Denunzierung aller, die sich für Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen. Freilich verstehen sich auch als „Gutmensch“ denunzierte als solche und lassen das in ihren Einstellungen auch erkennen. Meist gut gebildete Akademiker_innen in gut bezahlten Berufen erleichtern ihr Gewissen mit Spenden für NGOs und Bekenntnissen für fortschrittliche Projekte. Aber ihre Lebensweise ist trotzdem oft auch nur eine Form der Parallelgesellschaft.
Etwa wenn sie in Eigenheimen mit allem Drum und Dran weit draußen im Grünen, in gutbürgerlichen Vorstadtvierteln oder teuren Dachterrassenwohnungen in Innenstädten wohnen. Wenn sie als kritische Konsument_innen die Nase über jene rümpfen, die nicht Bio einkaufen. Wenn sie nur unter ihresgleichen verkehren und ihre Kinder in teure Privatschulen oder alternative Kindergärten schicken, weil sie ihnen keine öffentlichen Einrichtungen mit hohem Anteil von Migrant_innenkindern zumuten wollen.
So zeigt sich, dass die „Gesellschaft“ keineswegs ein einheitlicher Organismus ist, sondern höchst differenziert. Konnte man vor einem Jahrhundert noch Proletariat und Bourgeoisie als sich konträr gegenüberstehende Klassen sehen, so hat im heutigen Kapitalismus die Differenzierung geradezu extreme Ausmaße angenommen und muss wohl von vielen nebeneinander existierenden, aber auch miteinander verflochtenen Parallelgesellschaften gesprochen werden.
Die aktuell vielzitierte Mittelschicht ist kein klassenmäßiges, sondern ein soziologisches Konstrukt. Dazu können sowohl gut verdienende lohnabhängige Facharbeiter_innen oder Angestellte wie auch gut situierte Selbständige gezählt werden. Als Globalisierungsgewinner_innen ist für sie der Anspruch auf ein „gutes Leben“ zwar einigermaßen realisiert. Sie wollen aber weiter nach „oben“ kommen und rümpfen mangels Solidaritätsbewußtsein die Nase über die da „unten“, übersehen dabei aber, dass sie im neoliberalen Turbokapitalismus selber Gefahr laufen nach unten abzurutschen.
Für den neoliberalen Kapitalismus sind soziales Denken und gesellschaftliche Solidarität Teufelszeug, das verträgt sich überhaupt nicht mit schrankenloser Konkurrenz und Wettbewerb. Obwohl der Neoliberalismus spätestens mit der Krise von 2008 als gescheitert gelten muss, dominiert er als gesellschaftliches Bewusstsein weiter und blockiert längst fällige Veränderungen. Dazu gehören auch Konstrukte wie Parallelgesellschaften und andere Abgrenzungen, die solidarisches Denken und Handeln blockieren und die es daher zu überwinden gilt.
Leo Furtlehner ist verantwortlicher Redakteur der „Arbeit“