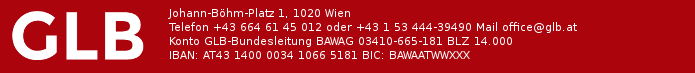Soziale Arbeit macht krank
- Mittwoch, 4. Juli 2012 @ 12:37

 Von Thomas Erlach
Von Thomas ErlachIm Sozialbereich in Österreich steigt der Druck auf die Beschäftigten von Jahr zu Jahr an. Der steigende Bedarf an sozialen Diensten steht in einem enormen Spannungsverhältnis zur Finanzierungsunlust der politischen EntscheidungsträgerInnen.
So bleiben seit mehr als zehn Jahren die zur Verfügung gestellten Mittel hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück. Das geht offensichtlich auf Kosten der Gesundheit der im Sozialbereich beschäftigten Menschen. Eine Studie von work@sozial ergab, dass 33 Prozent der MitarbeiterInnen hochgradig Burn-Out-gefährdet sind. Das ist einer der höchsten bekannten Branchenwerte. Doch obwohl diese Tatsachen schon lange bekannt sind, hat sich aus der Politik noch niemand bemüßigt gefühlt, hier etwas zum Positiven zu verändern.
Viele Belastungen
Die Beschäftigten im Sozialbereich sind dabei verschiedensten Belastungen ausgesetzt. Lärm, wenn KlientInnen ihren Gefühlen lautstark Ausdruck geben; schweres Heben, zum Beispiel in der mobilen Hauskrankenpflege; Schmutz, wenn zum Beispiel mit verschmutzter Wäsche gearbeitet wird; Gefahr, weil gewalttätige Übergriffe von KlientInnen auf MitarbeiterInnen in den letzten Jahren stark zugenommen haben.
Und auch emotionale Belastungen, weil es durchaus anstrengender Reflexionsarbeit bedarf, um mit den KlientInnen mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden, uvm. Als wäre das nicht schon genug, hat sich diese bereits aus der Vergangenheit bekannte Belastungssituation in den letzten zehn Jahren durch neue, aus der Ökonomisierung des Sozialbereichs entstandene Belastungen verschärft.
Bereits in den 1990er Jahren hat die Politik ihr Wohlwollen gegenüber dem Sozialsystem verloren. Seit dem wird behauptet, dass die Ausgaben für sozialstaatliche Angebote die Schuld an so ziemlich allem haben was in Österreich nicht gut läuft. Begleitet von einer Propagandaschlacht ungeahnten Ausmaßes, besteht die Krönung der Argumentationskette momentan darin, dass eine Krise auf dem Finanzmarkt zuerst zu einer Staatsschuldenkrise und schließlich zu einer Krise eines angeblich zu teuren Sozialsystems umdefiniert wurde. Dabei war es gerade unser Sozialsystem, dass schlimmere Auswirkungen der Krise in Österreich verhindert hat, und bei einer Ausdehnung der Sozialleistungen wären die Folgen noch geringer gewesen.
Zerschlagung des Sozialstaates
Seit dem Beitritt Österreichs zu Europäischen Union wird auf der politischen Ebene konsequent an einer Zerschlagung unseres Sozialstaates gearbeitet. Da dieser aber bei der Bevölkerung durchaus sehr beliebt ist, geschieht das eben scheibchenweise. Zur Steuerung dieses Zerstörungsprozesses wurden New Public Management-Instrumente wie das oberösterreichische Chancengleichheitsgesetz eingesetzt, wobei die öffentlichen Verwaltungen die ganze Gestaltungsmacht für sozialstaatliche Angebote an sich gebunden haben und nun unter dem Deckmäntelchen der Effizienzsteigerung die Angebote verknappen und so Sozialabbau betreiben.
Für die MitarbeiterInnen bedeutet dies, dass sie immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit erledigen müssen. Wobei die Leistungsvorgaben oft so angesetzt sind, dass sie nie erreicht werden können. Immer mehr Menschen müssen durch die Einrichtungen geschleust werden. Es kam zu einer Standardisierung der Arbeitsabläufe, zu einer Mechanisierung, bei der die Beziehung zwischen MitarbeiterIn und KlientIn auf der Strecke geblieben ist.
Gleichzeitig muss immer mehr Zeit aufgewendet werden, um Zahlen zu erheben und zu dokumentieren. Die soziale Arbeit wird auf bloße Zahlen reduziert, auf Häufigkeiten, die nichts über die Qualität der Arbeit aussagen. Beziehungsweise wurde das Erreichen von Zahlenvorgaben zur neuen Qualität im Sozialbereich.
Zu HandlangerInnen degradiert
Die ArbeitnehmerInnen leiden aber auch darunter, dass sie nun keine Möglichkeit mehr haben, die Fachlichkeit ihrer Professionen selber weiterzuentwickeln, da von Seiten des Geldgebers genau vorgegeben wird, wie soziale Arbeit umzusetzen ist. Die durchwegs gut qualifizierten MitarbeiterInnen werden zu bloßen HandlangerInnen degradiert, was für sie äußerst belastend ist.
Die Politik wirft den Beschäftigten im Sozialbereich vor, dass sie unverschämt viel verdienen. Dabei liegen die Durchschnittseinkommen im Bereich des Kollektivvertrages für Gesundheits- und Sozialberufe um ca. 25 Prozent hinter denen des Einzelhandels und um ca. 56 Prozent hinter denen der Metallindustrie. Diese Diffamierung durch den Geldgeber schmerzt und wird zur Belastung.
Gleichzeitig wird von politischer Seite verordnet, dass der im Kollektivvertag festgelegte Mindestlohn die Obergrenze der Finanzierung darstellt. Der Sozialbereich ist somit der erste Sektor, in dem von der Politik ein Höchstlohn eingeführt wurde. Dabei wäre das in Bereichen wie der Finanzwirtschaft, des Bankenwesens, oder der Wirtschaftsmanager viel logischer, weil dort ja die Einkommen bekannterweise ungleich höher sind.
Arbeitsplätze vernichtet
Jedes Jahr werden im Sozialbereich Kürzungen vorgenommen und Arbeitsplätze vernichtet. Dabei werden bevorzugt ältere und besser qualifizierte Beschäftigte auf die Straße gesetzt. Generell werden durch die Finanzierungsvorgaben der öffentlichen Hand ältere DienstnehmerInnen diskriminiert, da sie in der Regel nach ca. 15 Jahren Betriebszugehörigkeit den vorgegeben engen Budgetrahmen sprengen. Da dies von der Politik und manchen Geschäftsführungen bei jeder Gelegenheit betont wird, ergeben sich daraus Belastungssituationen, die sonst nur aus dem Mobbing bekannt sind. Man kann sagen, dass die älteren MitarbeiterInnen des gesamten Sozialbereichs vom Geldgeber systematisch gemobbt werden.
Im Bereich der mobilen Hauskrankenpflege in Oberösterreich hat der Geldgeber verkündet, dass er in Zukunft nur mehr einen Anbieter für alle Leistungen in einem Bezirk haben möchte. Die Sozialvereine werden zu Umstrukturierungen gezwungen. MitarbeiterInnen sollen zum Arbeitgeberwechsel gezwungen werden. Natürlich werden die Arbeitsbedingungen dabei wieder schlechter und zufällig fallen wieder einige ältere ArbeitnehmerInnen aus dem System. Die Verunsicherung in den Belegschaften ist groß. Die Existenzangst steigt. Diese Zustände sind keineswegs gesundheitsfördernd.
Die hohe Rate der Burn-Out-Gefährdung wird angesichts der beschriebenen Umstände nachvollziehbar. Die Aussichten für die Zukunft sind düster. Mit dem Fiskalpakt soll nun auf der Ebene der Europäischen Union die stückweise Abschaffung des Sozialstaates zum System gemacht werden. Durch die Begrenzung der Sozialausgaben, unabhängig vom steigenden Bedarf, werden die Mittel im Sozialbereich noch knapper werden. Angebote werden weiter nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Arbeitsplätze werden weiterhin vernichtet. Ältere ArbeitnehmerInnen werden weiterhin aus dem Sozialbereich entfernt werden.
Weder die ArbeitgeberInnen, die ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten hier nicht nachkommen, noch die PolitikerInnen, die die Auswirkungen ihrer Politik zu verantworten haben, sind hier bisher positiv aufgefallen. Die Arbeitgeber sehen meistens erst dann Handlungsbedarf, wenn sie aufgrund von zu vielen erkrankten MitarbeiterInnen, ihre mit dem Geldgeber vereinbarten Leistungen nicht mehr erbringen können.
Desinteressierte Politik
Darauf, dass die PolitikerInnen an dieser Situation etwas ändern, können wir lange warten. Es besteht ein breiter Konsens aller Parlamentsparteien über den eingeschlagenen Weg des Sozialabbaus. Dass soziale Arbeit krank macht interessiert auf der Ebene der Politik niemanden. Wir werden unsere Zukunft wohl selber in den Hand nehmen müssen. Es wird sich nur etwas ändern, wenn möglichst viele von uns diese Politik ablehnen und dagegen auftreten.
Auch wenn das jetzt kitschig klingt: Wenn wir darauf warten, dass andere das für uns richten, dann sind wir verloren. In diesem Sinne wünsche ich mir, möglichst viele von Euch bei den nächsten Arbeitskämpfen, und die werden nicht lange auf sich warten lassen, auf der Straße bei Demonstrationen und Aktionen zu treffen. Werden wir aktiv, damit soziale Arbeit eben nicht mehr krank macht.
Thomas Erlach ist Praxeologe und Stv. BRV von EXIT-sozial Linz