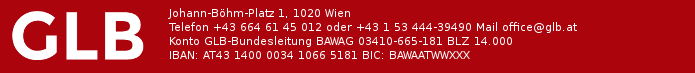Muss der Staat marode Banken retten?
- Freitag, 6. April 2012 @ 09:56
 Von Franz Gall, Judith Vorbach und Susanne Wixforth
Von Franz Gall, Judith Vorbach und Susanne WixforthHätte jemand 2006 vorhergesagt, dass Banken im großen Stil mit Hilfe öffentlicher Gelder aufgrund ihrer „Systemrelevanz“ vor dem Konkurs bewahrt werden würden, hätte man wohl realitätsferne Marktfeindlichkeit vorgeworfen. Inzwischen scheint man sich daran gewöhnt zu haben. Weil der Konkurs einer systemrelevanten Bank aufgrund ihrer Größe und starken Vernetzung mit anderen Institutionen das Finanzsystem destabilisieren würde, gilt ihre „Rettung“ als das geringere Übel. Unter dem Schock der internationalen Bankenkrise wurde auch in Österreich tief in die Staatskasse gegriffen: In Form direkter Kapitalunterstützung (gestaltet als Partizipationskapital ohne Mitspracherechte) an die Erste Bank, Volksbanken AG, Raiffeisen Zentralbank, BAWAG/PSK und Hypo Alpe Adria wurden etwa 5,9 Mrd. Euro aufgewendet, wofür die Institute im Vergleich zum Marktpreis günstige Dividenden zahlen. Besonders ins Gewicht fallen die Notverstaatlichungen der Hypo Alpe Adria, der Kommunalkredit AG und der Volksbank AG. Außerdem wurden Haftungen übernommen und es kam zu einer Anhebung der Einlagensicherung. Bis jetzt ergibt sich aus der „Bankenrettung“ eine budgetäre Nettobelastung (die dem Staat endgültig erwachsen ist) von 3,375 Mrd. Euro.
Die Meinungen, ob die unterstützten Banken tatsächlich „systemrelevant“ sind, gehen im Einzelfall auseinander. Schließlich ist es alles andere als trivial, die genauen Folgen eines Bankenkonkurses zu prognostizieren. Auch wenn grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die österreichischen Großbanken systemrelevant sind, muss eine akribische Prüfung in jedem Einzelfall vorgenommen werden. Dies nicht nur aufgrund der hochproblematischen Sozialisierung privater Verluste, sondern es muss auch vermieden werden, dass Banken unter der Annahme, sie würden ohnehin „gerettet“, überhöhte Risiken eingehen. Der Anreiz dazu ist schließlich aufgrund des Wettbewerbsdrucks systemimmanent.
Die Diskussion setzt sich bei der Gestaltung der „Bankenrettung“ fort: Steigt der Staat als echter Aktionär ein und bestimmt so die Geschäftspolitik mit? Wann müssen endlich auch die private Aktionäre/-innen selbst entsprechende Verluste tragen? Welche Bedingungen (bezogen auf Ausschüttungen, Kreditvergabe, Geschäftspolitik, etc.) werden an die Stützung geknüpft? Ursprünglich hatte Österreich geplant, die Stützungsmaßnahmen sogar gratis zuzuwenden. Im Zuge der Krise legte die EU-Kommission jedoch bestimmte Mindestvoraussetzungen als Gegenleistung für die staatlichen Zuwendungen fest. Die „Rettung“ im Einzelfall muss diese Bedingungen einhalten. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt in Verträgen zwischen der Republik und dem jeweiligen Finanzinstitut.
2008 verkündete Angela Merkel: „Keine Bank darf so groß sein, dass sie wieder Staaten erpressen kann.“ Tatsächlich wurden etliche Regulierungs- und Aufsichtsmaßnahmen eingeleitet (zum Beispiel zu Eigenkapitalbestimmungen), deren Umsetzung sich aber auch aufgrund massiven Lobbyings des Finanzsektors bis heute als äußerst zäh erweist. Jüngst plant man, Banken zu einem „Testament“ zu verpflichten, sodass ihre Abwicklung im Notfall erleichtert wird, und nimmt (endlich) das Schattenbankwesen ins Visier. Ein spezifisch österreichischer Unsicherheitsfaktor ist das überaus hohe Engagement der Banken in Osteuropa.
Bleibt zu hoffen, dass die vorgesehene Abgrenzung der Geschäfte zwischen Zentrale und ausländischen Tochterbanken und ein Verbot von riskanten Fremdwährungskrediten ausreichend stabilisierend wirken. Weltweit ist aber der Nicht-Erfolg der Regulierungsinitiativen frustrierend, denn noch immer sind Banken so groß, dass sie „Staaten erpressen“ können. Auch in Österreich gibt es noch große Unsicherheiten: die KA Finanz AG (Bad Bank der verstaatlichten Kommunalkredit AG) hat das größte CDS-Portfolio (Ausfallsversicherung für Anleihen) der Welt, der derzeitige Wert der Ausfallshaftung beträgt rund 500 Mio. Euro. Aber auch bei der Hypo Alpe Adria beträgt die Bandbreite der geschätzten Ausfallsrisiken für die nächsten Jahre zwischen einer Milliarde Euro (laut Republik Österreich) und 10 Milliarden Euro (laut EU-Kommission).
Trotz dieser Entwicklungen denkt man nicht ernsthaft an eine Infragestellung neoliberaler Dogmen, beispielsweise der Effizienzmarkthypothese. Stattdessen wurde die Krise zur „Staatsschuldenkrise“ umgedeutet. Während diese zu harten Kürzungsprogrammen gezwungen sind, verhallen Forderungen nach einer Trennung zwischen Kommerz- und Investmentgeschäft, einer Vergesellschaftung von Banken und selbst einer EU-Finanztransaktionssteuer in einer verwirrten Debatte.
Während die Europäische Zentralbank die Geschäftsbanken mit Liquiditätsmaßnahmen in Höhe von gut einer Billion Euro „aufpäppelt“, ist sie weit davon entfernt, gegenüber Staaten als „Kreditgeber der letzten Zuflucht“ aufzutreten. In Folge sind die Staaten selbst dem krisengeschüttelten Finanzmarkt ausgeliefert. Mit der Begründung, man müsse diese Märkte beruhigen, werden die so genannten „Rettungsschirme“ immer mehr aufgebläht. Eine umfassende Neugestaltung des Finanzsektors, bei der die Interessen der Allgemeinheit endlich Vorrang vor Einzelinteressen haben, ist für eine positive Zukunft Europas unabdingbar - wenn auch nicht hinreichend.
Franz Gall und Judith Vorbach sind MitarbeiterInnen der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik der AK-OÖ, Susanne Wixforth ist Mitarbeiterin der AK-Wien