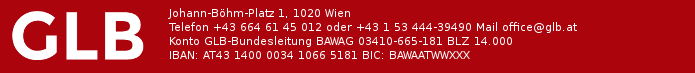Hypo-Pleite zeigt Problematik von Mitarbeiterbeteiligungen
- Mittwoch, 20. Juli 2011 @ 14:24
 Auf einen höchst bedenklichen Aspekt der sozialpartnerschaftlich von ÖGB, AK wie auch WKO und Industriellenvereinigung immer hochgejubelten Mitarbeiterbeteiligungen (MAB) weist die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) im Zusammenhang mit Haftungsfragen bei der Milliardenpleite der Kärntner Hypo Alpe Adria hin. Dort sind vor kurzem die im Vorstand der Mitarbeiter Privatstiftung vertretenen Betriebsräte zurückgetreten, offensichtlich um einer allfälligen Haftung zu entgehen. Die Mitarbeiterbeteiligung war einst Aktionär der Bank und kassierte beim Hypo-Verkauf an die Bayerische Landesbank mit. Jetzt fordert jedoch die BayernLB die Rückzahlung einer Sonderdividende von 50 Millionen Euro, die den Altaktionären 2008 ausbezahlt wurde. Davon entfallen anteilig 2,5 Millionen Euro auf die Mitarbeiterstiftung.
Auf einen höchst bedenklichen Aspekt der sozialpartnerschaftlich von ÖGB, AK wie auch WKO und Industriellenvereinigung immer hochgejubelten Mitarbeiterbeteiligungen (MAB) weist die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) im Zusammenhang mit Haftungsfragen bei der Milliardenpleite der Kärntner Hypo Alpe Adria hin. Dort sind vor kurzem die im Vorstand der Mitarbeiter Privatstiftung vertretenen Betriebsräte zurückgetreten, offensichtlich um einer allfälligen Haftung zu entgehen. Die Mitarbeiterbeteiligung war einst Aktionär der Bank und kassierte beim Hypo-Verkauf an die Bayerische Landesbank mit. Jetzt fordert jedoch die BayernLB die Rückzahlung einer Sonderdividende von 50 Millionen Euro, die den Altaktionären 2008 ausbezahlt wurde. Davon entfallen anteilig 2,5 Millionen Euro auf die Mitarbeiterstiftung.Als die voestalpine 2003 endgültig voll privatisiert wurde, brüstete sich die FSG mit der Mitarbeiterbeteiligung, derzeit 13 Prozent, als Schutz gegen eine feindliche Übernahme. Voest-Boss Wolfgang Eder wiederum warnte vor kurzem vor einer „Jugoslawisierung“ – gemeint war zu viel Mitbestimmung ähnlich der früheren Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien – sollte die MAB über 20 Prozent erhöht werden: „Damit wird deutlich, dass solche Beteiligungen vor allem billiges Kapital für das jeweilige Unternehmen bereitstellen sollen, solange Unternehmen florieren und hohe Gewinne erzielt werden bleiben die Risiken ausgeblendet“ meint dazu GLB-Bundesvorsitzender Josef Stingl.
Wie konfliktträchtig Mitarbeiterbeteiligungen werden können zeigt das Beispiel der AMAG. Dort führte die 1996 realisierte Beteiligung zu massiven Konflikten die zeitweise sogar zu Massenaustritten aus dem ÖGB führten. Beim Verkauf der Hälfte der ursprünglich 20 Prozent MitarbeiterInnenbeteiligung wurden an 1.650 aktive und 300 pensionierte Beschäftigte 55,4 Millionen Euro ausbezahlt. Rund 300 in der Zwischenzeit gekündigte oder ausgeschiedene Beschäftigte mussten hingegen durch die Finger schauen.
Der GLB lehnt daher die windigen Modelle von MitarbeiterInnen-, Erfolgs- oder Gewinnbeteiligungen ab, die bezeichnenderweise von Bankern wie dem oö Raiffeisen-Boss Ludwig Scharinger als „wichtiges Puzzlestück für mehr Gerechtigkeit“ beworben werden. Mittlerweile musste auch der oö AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzende Johann Kalliauer eingestehen, dass MitarbeiterInnenbeteiligungen „auf keinen Fall als Ersatz für kollektivvertragliche Lohn- und Gehaltserhöhungen dienen“ dürften.
„Die Diskussion über solche Beteiligungen ist eine Reaktion auf eine nicht mehr zu ignorierende Verteilungsdebatte, sie ist allerdings die falsche Antwort darauf“, so Stingl. Statt den Lohnabhängigen den ihnen zustehenden Anteil am Produktivitätswachstum zuzugestehen, will man sie als Miteigentümer in die Pflicht nehmen und ihnen zum vorhandenen Risiko des Arbeitsplatzverlustes auch noch zusätzlich das Unternehmerrisiko aufhalsen.