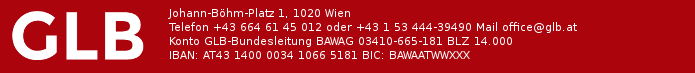Die Arbeit der „Anderen“
- Montag, 31. Januar 2011 @ 13:23

 Von Alexandra Weiss
Von Alexandra WeissÜber Wert und Entwertung von Arbeit
In den Diskussionen über die Arbeitsgesellschaft wird nur selten über Wert und Bewertung von Arbeit diskutiert. Die Bewertung von Arbeit hängt in unserer Gesellschaft nicht zuletzt davon ab, wer sie macht. Sexismus und auch Rassismus sind nicht nur politische Ausschlussmechanismen, sie sind auch Formen kultureller Missachtung, die mit einer Entwertung der Arbeit der betroffenen Gruppen einhergeht. Drei Diskussionspunkte dazu werden im Folgenden kurz angerissen: 1. Die Kontinuität des verkürzten (männlichen) Arbeitsbegriffs
Historische und aktuelle soziale Bewegungen und ihre institutionellen Ausformungen, wie Gewerkschaften, sehen bis heute den politisch zu bearbeitenden Widerspruch in erster Linie im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, ohne ernsthaft bereit zu sein, die nicht-entlohnte Arbeit als Basis kapitalistischen Wirtschaftens zu begreifen. So wird die Ausbeutung von Frauen in der Hausarbeit, der Pflege, der Kindererziehung zu einer „privaten“ Frage. Hintergrund sind hierarchische Geschlechterverhältnisse, die sich über die Formen der Arbeit „drüberlegen“ und dafür sorgen, dass Frauenarbeit zum einen überhaupt nicht als Arbeit wahr- oder ernstgenommen wird, oder am Erwerbsarbeitsmarkt entwertet wird, nicht zuletzt auch weil Frauen in ihrer soziale Sicherung oder Existenzsicherung nicht als Individuen gedacht werden, sondern im Zusammenhang mit Familie oder (Ehe-)Mann.
Auch wenn die Kleinfamilie als Sinn und Inhalt eines Frauenlebens durch die gesellschaftliche Realität inzwischen massiv in Frage gestellt wurde und auch in der politischen Rede längst eine modernere Rhetorik Platz gegriffen hat, halten sich die Institutionen zur Absicherung dieser Kleinfamilie hartnäckig und sorgen dafür, dass weibliche Autonomie – für die allermeisten Frauen – prekär bleibt oder schlicht nicht erreichbar ist. Armut von Frauen verfestigt sich so und wird politisch hingenommen.
Ein Grund dafür liegt darin, dass feministische Forderungen auf Arbeitsmarktintegration oder Fragen der Gleichbehandlung verkürzt werden. Gleichzeitig werden mit der Demontage des Sozialstaates Anforderungen an Frauen als „Wohlfahrtsproduzentinnen“ herangetragen: sie sollen den Sozialstaatsabbau sozial verträglich gestalten – ganz privat. Die bekannten Diskussionen über den „Pflegenotstand“ die Gefährdung der Familie über BürgerInnen- und Freiwilligenarbeit machen das deutlich.
2. Politik gegen die Entwertung von Arbeit
Eine emanzipatorische Politik gegen die Entwertung von Arbeit muss all das im Blick haben – entgegen einer sich wieder etablierenden Haupt- und Nebenwiderspruchlogik aber auch einer alternativen oder Gemeinwohl-Ökonomie, die Spaltungen entlang von Geschlecht, Ethnie und Klasse kaum in Analysen und Gesellschaftsentwürfe integriert.
Die kulturelle und die ökonomische Dimension der Diskriminierung von Frauen und von ethnischen Gruppen sind „gleich-ursprünglich“, die eine ist nicht aus der anderen ableitbar. Deshalb wird eine Politik der Umverteilung Rassismus und Sexismus nicht zum Verschwinden bringen, ebenso, wie eine Politik der Anerkennung ungeeignet ist soziale Ungleichheit und Armut zu bekämpfen.
Für emanzipatorische Politik kann es nicht darum gehen eine Vorrangigkeit entweder ökonomischer oder kultureller Diskriminierung und Ungleichheit zu postulieren, sondern deren Verwobenheit sichtbar zu machen und zu politisieren. Mehrfach hat man in politischen Kämpfen schon die Erfahrung gemacht, dass die Trennung der Zusammenhänge von Klassenherrschaft, Geschlechterhierarchie und Rassismus im Kapitalismus ein Mittel der Spaltung und der Stabilisierung von Herrschaftsverhältnissen war und ist. Das sollte deutlich gemacht haben, dass emanzipatorische Politik, ohne die „Anderen“, die Nicht-Weißen und die Frauen, nicht geeignet ist, Herrschaftsverhältnisse, Gewaltverhältnisse und Ungleichheit zu beseitigen.
3. Alternativen der Arbeitsgesellschaft und ihre geschlechterpolitischen Implikationen
Die Krise der Arbeitsgesellschaft manifestiert sich v.a. darin, dass die durch Produktivitätssteigerung frei werdende Zeit, nicht den Menschen zugutekommt, sondern sich in Form von Arbeitslosigkeit, zeitlich reduzierten und nicht existenzsichernden Arbeitsverhältnissen gegen die Menschen kehrt. Als Alternativmodell dominant ist in der Diskussion das bedingungslose Grundeinkommen. Ich möchte hier auf eine paar Schwierigkeiten dieses Modells aus feministischer Perspektive aufmerksam machen. Hauptkritikpunkt ist m.E., dass in diesen Modellen die Lebenssituation von Frauen kaum zum Ausgangspunkt genommen wurde – feministische Kritik formulierte schon vor 20 Jahren, dass „Dekommodifizierung“, also die Abkoppelung der Existenzsicherung vom Arbeitsmarkt, für Frauen meist dazu führt, dass sie für unbezahlte Arbeit verantwortlich gemacht werden – unter den gegenwärtigen Bedingungen (3/4 der unbezahlten Arbeit im Haus, in der Pflege, in der Kindererziehung wird von Frauen geleistet) ist diese Perspektive sehr wahrscheinlich. Die Attraktivität des Modells, mit seinem Versprechen nach mehr Autonomie und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, basiert daher m.E. auf einem Absehen von hierarchischen Geschlechterverhältnissen und davon, wie die meisten Frauen und Männer leben. Folge wird dann eine Zementierung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und eine Re-Privatisierung sozialer Dienstleistungen sein.
Zentral ist es die Frage der Umverteilung – und die ist auch bei einem Grundeinkommen nötig – radikaler zu stellen. Es könnte schließlich auch um eine Demokratisierung von Arbeitsverhältnissen, Arbeitszeitverkürzung, eine Befreiung der Arbeit, statt von der Arbeit gehen – es könnte darum gehen über den Sinn von Arbeit zu diskutieren und „sinnlose“ Arbeit in Frage zu stellen. Eine grundsätzliche Kritik an der (Lohn-)Arbeit muss sich mit deren Gestaltung, mit Forderungen nach der Einflussnahme auf die Inhalte der Arbeit und mit einer Vergesellschaftung und Verberuflichung von Erziehungs-, Betreuungs- und Pflegearbeit befassen. Werden all diese Inhalte abgeschnitten, so besteht unter den gegenwärtigen Bedingungen die Gefahr, dass ein Grundeinkommen zur Befriedung „überflüssiger“ Arbeitskräfte verkommt und zu Stigmatisierung und Ausgrenzung führt. Verteilungsgerechtigkeit wird so kaum hergestellt, wenn nicht die Form der Arbeit, der Arbeitsbegriff und seine Reduktion auf Lohnarbeit, die Verteilung der bezahlten und der unbezahlten Arbeit sowie die Be- und Entwertung von Arbeit diskutiert wird.
Und zu guter Letzt geht es auch darum, den Zusammenhang von Arbeit und geschlechtlicher Identität aufzubrechen. Denn solange sich Männer entmännlichen fühlen, wenn sie „typische“ Frauenarbeit verrichten oder wenn sie als Familienerhalter nicht „funktionieren“ und Frauen sich „entweiblicht“ fühlen oder Kritik ernten, wenn sie ihre Arbeit im Haushalt und in der Erziehung nicht als oberste Priorität setzen oder die Arbeitsverhältnisse dies schlicht nicht erlauben, bleibt eine hierarchische Geschlechterordnung und traditionelle Formen von Arbeit und Leben aufrecht.
Alexandra Weiss ist Politikwissenschafterin in Innsbruck
Der Artikel ist ein Auszug aus dem Beitrag: Alexandra Weiss (2010). Die Arbeit der „Anderen“. In: Sabine Gruber/Frigga Haug/Stephan Krull (Hg.): Arbeiten wie noch nie!? Unterwegs zur Handlungsfähigkeit, Hamburg, Argument Verlag, 89-112.