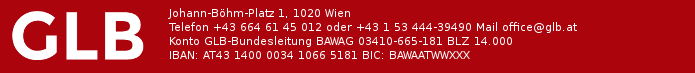In Bewegung kommen - umverteilen!
- Samstag, 11. Dezember 2010 @ 20:13

 Referat von Karin Antlanger bei der GLB-Bundeskonferenz am 11.12.2010
Referat von Karin Antlanger bei der GLB-Bundeskonferenz am 11.12.2010Der Zeitraum seit unserer letzten ordentlichen Bundeskonferenz im Sommer 2007 war und ist von der tiefsten Krise des realen Kapitalismus seit den 30er Jahren bestimmt. Ausgelöst durch die Lehman-Pleite im September 2008 war das Platzen der über Jahre hinweg aufgestauten Immobilien-Blase in den USA der Ausgangspunkt für eine Finanzkrise, die sehr rasch die Realwirtschaft erfasst hat. Ausschlaggebend und folgenreich zugleich dabei war, dass der Finanzmarkt seit der Freigabe des Kapitalverkehrs in den 80er Jahren eine schier unglaubliche Dimension angenommen hat. Jede durch die Spekulation mit immer abenteuerlicheren Finanzprodukten ausgelöste Pleite schlägt mit immer größerer Wucht auf die Realwirtschaft und damit auf die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen zurück.
Hätte die Finanzkrise nur jene betroffen, die durch die Entwicklungen am Finanzmarkt jahrelang Superdividenden und Superprofite eingestreift haben, könnten wir uns gelassen zurücklehnen und das Schauspiel erste Reihe fußfrei genießen. Tatsächlich aber haben Banken und die am Finanzmarkt profitierenden Eliten schon längst die Politik in Geiselhaft genommen: „Wie kriegt die Politik das Finanzwesen in den Griff, wenn das Finanzwesen die Politik im Griff hat?“ hat der frühere Chef des AMS-Oberösterreich, Roman Obrovski, dies treffend auf den Punkt gebracht.
Die Lohnabhängigen zahlten und zahlen mittlerweile bereits mehrfach für diese Fehlentwicklung: Zuerst zahlten sie drauf, indem ihnen jahrelang bei den Lohn- und Gehaltsverhandlungen der ihnen zustehende Anteil an der Produktivitätsentwicklung vorenthalten wurde. Die Gewerkschaftsspitzen gingen bereitwillig als brave Sozialpartner dem Unternehmerslogan von der Standortsicherheit auf den Leim. Die zusätzlichen Gewinne wurden aber nicht in die Unternehmen investiert, sondern zum größten Teil auf dem Kapitalmarkt verspekuliert.
Weiters haben die Regierungen - egal ob rotschwarz, schwarzblau oder schwarzorange - durch eine falsche Steuerpolitik, seit den 80er Jahren Profite und große Vermögen immer stärker entlastet. Das bedeutet auf der Kehrseite, dass wir mit Lohnsteuer, Mehrwertsteuer und anderen Massensteuern einen immer größeren Anteil des Budgets finanzieren müssen.
Als die Krise offen zu Tage trat, wurde entgegen dem jahrelang gepredigten Slogan „Mehr privat, weniger Staat“ von Banken und Konzernen umgehend der geschmähte Staat zur Rettung gerufen anstatt einige keineswegs systemrelevante Banken und ihre AktionärInnen in die Pleite zu schicken. Die Milliardenpakete dürfen wiederum die Lohnabhängigen mit ihren Steuern finanzieren. Von der längst notwendigen Vergesellschaftung der Banken will die Regierung natürlich nichts hören. Und nach einer Schrecksekunde, in der von Konsequenzen oder gar einem „Kapitalismus neu“ die Rede war, machten Bank- und Konzernherren so weiter wie vor der Krise als ob nichts geschehen wäre und verkaufen bereits wieder flott hochriskante Finanzprodukte wie jüngst Georg Rathwallner, Konsumentenschutzchef der oö Arbeiterkammer kritisierte.
Als nächstes zahlten die Lohnabhängigen nach dem Übergreifen der Krise auf die Realwirtschaft durch Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust und forcierte Prekarisierung neuerlich drauf. Und weil die Rettungspakete zwangsläufig mit einer verstärkten Staatsverschuldung verbunden waren ist jetzt Budgetsanierung angesagt. Die Regierung hat dazu ein Maßnahmenpaket für 2011 bis 2014 vorgelegt, das sich dadurch auszeichnet, dass die Belastung neuerlich auf die Masse der Bevölkerung abgewälzt wird. Von einer Vermögenssteuer oder Erhöhung der Steuern auf die meist schon wieder auf Vorkrisenniveau liegenden Profite wollen Faymann und Pröll natürlich nichts hören.
Die Aktion „Fair teilen“ des ÖGB oder die Kampagnen einiger SPÖ-Landesorganisationen für eine Vermögenssteuer waren offenbar nur dazu gedacht den Unmut an der Basis zu dämpfen, eine ernsthafte Mobilisierung war wohl nie angestrebt.
Wie zynisch die Politik der Herrschenden dabei ist, möchte ich am Beispiel Oberösterreich darstellen: Da wird vor dem Hintergrund leerer Kassen das Sozialbudget des Landes um 17 Millionen Euro gekürzt, die Mittel wichtige Teilbereiche der psychosozialen Vereine sogar um ein Drittel gekappt, was zwangsläufig mit der Einstellung von Krisendiensten, Beratungen usw. und Kündigungen verbunden ist. Gleichzeitig sieht es die Landespolitik als unproblematisch, wenn 53 Millionen Euro zur Mitfinanzierung des ökologisch wie verkehrspolitisch unsinnigen Westringes oder eine Subvention von 60 Millionen Euro für eine ebenso ökologisch wahnsinnige Skischaukel Warscheneck in Aussicht gestellt wird. Wie man sieht Umverteilung pur, aber in die falsche Richtung.
Verteilungspolitik ist die zentrale Frage
Die zentrale Frage der Verteilung bzw. Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, der nach wie vor durch die Arbeit der Lohnabhängigen geschaffen, aber von einer kleinen Minderheit angeeignet wird, steht daher im Mittelpunkt der Politik. Klar ist, dass die herrschenden Eliten nichts von Umverteilung hören wollen. Klar ist auch, dass es nur dann eine Änderung gibt, wenn genügend politischer Druck vorhanden ist. Daher haben wir bewusst auch das Motto „In Bewegung kommen - umverteilen!“ zum Thema unserer Bundeskonferenz gemacht.
Angesichts der Schieflastigkeit der gesellschaftlichen Verteilung wird das Thema „soziale Gerechtigkeit“ immer dringlicher. Das Geld dafür ist reichlich vorhanden, aber eben nur falsch verteilt.
* Davon zeugt etwa, wenn ein einziges Prozent der Bevölkerung ein Drittel, weitere neun Prozent das zweite Drittel des Vermögens in diesem Land besitzen und sich die restlichen 90 Prozent das letzte Drittel teilen dürfen.
* Davon zeugt auch, wenn 68.900 Euro-MillionärInnen satte 210 Milliarden Euro besitzen, aber die Regierung es nicht einmal für zumutbar hält, davon ein Prozent Vermögenssteuer, also zwei Milliarden Euro einzuheben.
* Davon zeugt weiters, wenn in mittlerweile 3.460 Privatstiftungen geschätzte 100 Milliarden Euro deponiert sind, seit 1994 bis dato weitgehend steuerfrei. Und diese Liste ließe sich weiter fortsetzen.
Hier kommt freilich auch die Rolle unserer SpitzengewerkschafterInnen, die auf hochdotierten Mandaten im Nationalrat und Bundesrat sitzen, ins Spiel. Es stellt sich die Frage, was für sie Vorrang hat, der Fraktionszwang ihrer jeweiligen Partei, vorwiegend also der SPÖ, oder die Interessen der Lohnabhängigen, die sie als GewerkschafterInnen eigentlich vertreten sollen. Und ich möchte dazu schon in aller Deutlichkeit feststellen: GewerkschafterInnen die im Parlament dem Belastungspaket der Regierung zustimmen, sind fehl am Platz und sollten diesen räumen, entweder indem sie sich aus dem Parlament zurückziehen oder indem sie ihre Gewerkschaftsfunktion zurücklegen. Man kann schließlich nicht Diener zweier Herren sein.
Drei wichtige Schwerpunktthemen
Wenn wir heute unsere Tätigkeit der letzten drei Jahre bilanzieren können wir feststellen, dass wir zumindest mit drei wichtigen Themen in Teilbereichen gewisse Debatten und auch Haltungsänderungen ausgelöst haben, nämlich mit der Forderung nach einem
* gesetzlichen Mindestlohn,
* der Arbeitszeitverkürzung und
* der Wertschöpfungsabgabe,
Themen die wir immer wieder in Gewerkschaften und Arbeiterkammern aufgerollt haben.
In der Debatte um die Milliardenpakete für Griechenland, Irland und möglicherweise weiteren EU-Ländern, die letztlich immer der Bankenrettung dienen, ist auch eines deutlich geworden: Nämlich dass u.a. ein Hintergrund der Krise ist, dass in Deutschland und auch in Österreich jahrelang mit dem berüchtigten „Standort“-Argument Lohnzurückhaltung zugunsten des Exportes geübt wurde. Gerade in diesen beiden Ländern stagnieren die Reallöhne seit 1995 ebenso wie die für den Wettbewerb entscheidenden Lohnstückkosten. Diese Lohnzurückhaltung wurde vom Kapital in keiner Weise honoriert, die Extragewinne nicht in die Unternehmen und damit in sichere Arbeitsplätze investiert, sondern am Kapitalmarkt verjuxt. Die Leitl-Formel „Die Gewinne von heute sind die Arbeitsplätze von morgen“ wurde damit als Lug und Trug entzaubert.
Als Folge blieb die Inlandsnachfrage mangels Kaufkraft zurück, Deutschland hat mit „Hartz IV“ unter rotgrüner Regie ein besonders negatives Beispiel massenhafter Prekarisierung vorgezeigt, Österreich ist mit der Bedarfsorientierten Mindestsicherung unter rotschwarzer Regie auf einem ähnlichen Weg.
Wir konstatieren seit Jahren die wachsende Prekarisierung, also dass immer weniger Menschen, vor allem junge, eine Chance auf einen vollwertigen sozial abgesicherten Arbeitsplatz erhalten, aber auch, dass bisher vollwertige Arbeitsplätze zugunsten von Teilzeit, Geringfügigkeit, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit usw. vernichtet werden. Weil für das Kapital Lohndumping und Sozialabbau angesagt sind.
In den letzten Tagen war in den Medien immer wieder zu hören, dass es in Österreich noch nie zuvor so viele Beschäftigungsverhältnisse gegeben hat. Kein Wunder, wenn in diesen Statistiken jede regelmäßige Beschäftigung, die mehr als eine Stunde pro Woche beträgt, gezählt wird. JedeR von uns kennt jemanden, der oder die zwei oder auch drei geringfügige Jobs hat, um sich irgendwie über Wasser zu halten.
Daher treten wir neben einer aktiven Lohnpolitik, die nicht nur die Inflation, sondern auch einen möglichst hohen Anteil des Produktivitätszuwachses abgelten muss, seit Jahren für einen gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde ein. Das sehen wir keineswegs im Widerspruch zur KV-Kompetenz der Gewerkschaften wie uns immer wieder vorgehalten wird. Eine hoffentlich unverdächtige Kronzeugin dafür ist die frühere stellvertretende DGB-Chefin Ursula Engelen-Kiefer, die kürzlich bei einer Europa-Tagung der oö Arbeiterkammer meinte „die Tarifpolitik der Gewerkschaften reicht nicht mehr aus“ und müsse daher durch Maßnahmen der Regierung unterstützt werden. Sie trat für einen gesetzlichen Mindestlohn ein, der „nicht unter 8,50 Euro pro Stunde“ liegen dürfe, weil es gelte prekäre Arbeit, Leiharbeit und geringfügige Arbeit einzudämmen.
Ebenso wichtig im Kampf gegen die Prekarisierung ist eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Situation bei der Arbeitszeit ist derzeit völlig schizophren: Der ÖGB hat zwar seit 1986 bei den Bundeskongressen regelmäßig die bereits in den 80er Jahren vom damaligen Sozialminister Dallinger angedachte 35-Stundenwoche gefordert. Praktisch hat sich der ÖGB allerdings völlig gegenteilig auf die berüchtigte Flexibilisierung der Unternehmerseite eingelassen. Das Ergebnis ist, dass Österreich heute einen Höchstwert bei der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigte in der EU verzeichnet. Gleichzeitig werden jährlich 370 Millionen Überstunden (davon ein Viertel unbezahlt) geleistet. Das entspricht rein rechnerisch rund 185.000 Vollzeitarbeitsplätzen.
Nach dem Stand der Produktivität wäre längst schon die 30-Stundenwoche möglich. Der Experte Jörg Flecker vom Institut FORBA fordert mit Verweis auf die enorme Produktivität einen „neuen gesellschaftlichen Arbeitszeitstandard“ bei 30 Stunden pro Woche anzusetzen um tendenziell Teilzeitarbeit überflüssig zu machen. Und laut Markus Marterbauer vom Wifo wird es ohne Arbeitszeitverkürzung nicht gelingen die krisenbedingt gestiegene hohe Sockelarbeitslosigkeit zu reduzieren. Es ist ein Fortschritt, dass Arbeiterkammer und ÖGB sich jetzt doch wieder auf die Notwendigkeit einer Arbeitszeitverkürzung besinnen. Der springende Punkt dabei wird freilich immer sein und bleiben, dass eine solche ohne Lohnverlust erfolgt, denn in anderer Form, als Kurzarbeit, Teilzeit usw. gibt es sie ohnehin schon zur Genüge.
Nicht nur wegen der Krise, durch welche zigtausende Menschen über die kapitalmarktfinanzierte Pensionsvorsorge mit der zweiten und dritten Säule durch die Finger schauen, steht die Finanzierung des Sozialsystems auf dem Prüfstand.
Tagtäglich wird uns von den neoliberalen Medien, ExpertInnen und von der Politik eingehämmert, dass wir uns das Sozialsystem nicht mehr leisten könnten. Mit dem Ausspruch „Die Diskussion über die Rente ist nichts anderes als der gigantische Versuch der Lebensversicherungen an das Geld der Leute heranzukommen“ hat freilich schon vor Jahren Heiner Geißler, ehemaliger Generalsekretär der CDU, die Absicht solcher Debatten auf den Punkt gebracht.
Laut Wertschöpfungsbarometer der oö Arbeiterkammer ist die Wertschöpfung pro Beschäftigten von 2002 bis 2008 um 28 Prozent, sind die Personalkosten aber um 19 Prozent, hingegen der Überschuss nach Abzug der Personalkosten um 46 Prozent gestiegen. Anstatt in die Unternehmen zu investieren wurden übermäßig Gewinne ausgeschüttet und in Finanzanlagen investiert.
Natürlich ist das Sozialsystem auch in Zukunft finanzierbar, wenn die Prioritäten richtig gesetzt und die Verteilung anders organisiert wird. Ein Aspekt dabei ist eine Wertschöpfungsabgabe, die bereits in den 80er Jahren vom schon erwähnten Sozialminister Dallinger gefordert, aber von der „Kronenzeitung“ als „Maschinensteuer“ diffamiert wurde und Dallinger auch vom ÖGB im Regen stehen gelassen wurde. Es geht dabei darum, die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung nicht nach der reinen Lohnsumme wie derzeit zu bemessen, sondern in die Bemessung alle Teile der Wertschöpfung einzubeziehen.
Beispiel Sozialabbau in Oberösterreich
Ein besonderes Beispiel in punkto Sozialsystem spielt sich zur Zeit in OÖ ab: hier hat die Sozialabteilung der Landesregierung vor etwa einem Monat mitgeteilt, dass sie die Finanzierung von psychosozialen Betreuungsleistungen ab 1. Jänner um 33 Prozent - ein ganzes Drittel – kürzen wird. Davon betroffen sind vor allem Angebote für Menschen mit Depressionen, Burn Out, Lebenskrisen, psychiatrischem Betreuungsbedarf – also Menschen, die alle nicht zu den sog. „Vorzeigebedürftigen“ zählen, weil sie sich entweder nicht gerne in der Öffentlichkeit outen oder auch auf wenig Verständnis und Empathie stoßen.
Nun reicht es aber: seit Jahren wird der Sozialbereich abgewertet, die MitarbeiterInnen entwertet, die Leistung ständig verdichtet (Schlagwort Ökonomisierung: Betriebswerte rechnen ständig vor, wie viel mehr gearbeitet werden soll – der Mensch ist aber nicht berechenbar – es ist entwürdigend, menschliche Nähe, Unterstützung und Verständnis nur in Zahlen zu gießen.)
Die öffentliche Hand geht offenbar davon aus, dass hier die Gegenwehr auch am geringsten ist, nicht zuletzt deswegen, weil im Sozialbereich sowieso nicht gestreikt werden könne, weil die BetreuerInnen ihre KlientInnen nicht im Stich lassen dürften. Nur: wenn ein Drittel der Beschäftigten gekündigt werden muss, dann lassen sie die KlientInnen für immer im Stich und nicht nur für die Zeit eines Streiks.
Daher findet ein Warnstreik zur Abwehr von 113 beim AMS-Frühwarnsystem angemeldeten Kündigungen am 13. und 14. Dezember statt, mit einer Betriebsversammlung beider Betriebe im öffentlichen Raum am 14. Dezember Nachmittag. Hinzuweisen ist auf eine laufende Unterschriftenaktion die bereits von 22.000 Menschen unterstützt wurde. Anzumerken ist, dass wegen eines 2-tägigen Warnstreiks noch nicht die Revolution ausbricht – aber es zeigt, dass auch Gegenwehr möglich ist (und das bei den sogenannten „Bleistiftspitzern“).
Gegen Privatisierung öffentlichen Eigentums
Ein kräftiges Nein gibt es von unserer Seite auch zu der immer wieder forcierten Privatisierung öffentlichen Eigentums. Bereits in der Ära der rotschwarzen Koalition von 1986 bis 2000 wurde die als eine der wichtigsten Grundlagen der 2. Republik entstandene und jahrzehntelang für Österreich bedeutende Verstaatlichte sowie der halbstaatliche und gemeinwirtschaftliche Sektor als Vorleistung für den EU-Beitritt gezielt zerschlagen. Der frühere ÖIAG-Chef Streicher brachte diese Politik mit der Aussage „Unser Katechismus ist das Aktienrecht“ auf den Punkt. Gleichzeitig wurden in diesem Zeitraum ÖBB und Post aus dem Bundesbudget ausgegliedert und Teile der Energiewirtschaft privatisiert.
Von der schwarzblau/orangen Regierung von 2000 bis 2006 erfolgte ein weiterer Schub der Privatisierung: So erfolgte der Verkauf der Bundeswohnungen und der Börsegang der Post sowie als Vorleistung für eine Privatisierung die Zerstückelung der ÖBB als Holding. Immer wieder gibt es Vorstöße zur Aufhebung der Bestimmungen des 2. Verstaatlichtengesetzes, das eine öffentliche Mehrheit in der E-Wirtschaft vorschreibt, wozu allerdings eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig ist. „Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter wünscht als Vorleistung für die Auflösung der ÖIAG die Restbestände von Staatsbesitz bei Post, Telekom und OMV zu privatisieren. Und als Draufgabe alle Beteiligungen der Länder. Da spricht über Brandstätter wohl die Stimme seines Herrn, des Raiffeisen-Imperiums.
Für uns stellt das öffentliche Eigentum einen wichtigen Baustein des Sozialstaates dar, den wir verteidigen und erhalten wollen. Und dort, wo es Fehlentwicklungen und Rückstände gibt wollen wir das öffentliche Eigentum aber auch auf eine neue Basis stellen. Ohne öffentliches Eigentum wird die Politik zunehmend entmachtet, wie sich immer wieder aufs Neue bestätigt. Denn wie sollen Parlament, Landtage oder Gemeinderäte politisch etwas gestalten können, wenn sie das Familiensilber verscherbeln?
Worauf zielt die Verwaltungsreform?
Im Zusammenhang mit der Budgetsanierung wird jetzt auch wieder das Thema Verwaltungsreform angezogen, eine Debatte, die sich seit zwei Jahrzehnten mit großer Zähigkeit durch die österreichische Politik zieht. Es sind dabei die Länder die auf der Bremse stehen und ein verkrustetes System verteidigen. Mit Pseudoargumenten wird die Absurdität verteidigt, dass ein so kleines Land wie Österreich neun verschiedene Jugendschutzgesetze, Bauordnungen, Sozialhilfegesetze usw. braucht. Die riesigen politischen Apparate der neun Landesregierungen sollen damit gerechtfertigt werden. Hingegen wurde der Druck nach unten auf die Gemeinden immer schon weitergegeben, wovon allein die Tatsache zeugt, dass die Gemeinden zu einer Maastricht-Null gezwungen wurden, wovon Länder und vor allem der Bund weit entfernt waren.
Manche sehen freilich eine solche Verwaltungsreform geradezu als Zaubermittel zur Kostensenkung. Nicht ausgesprochen wird dabei, dass eine solche Kostensenkung zugunsten einer schlanken und effizienten Verwaltung vor allem auf das Personal zielt, denn wo sonst will man so großartig einsparen. Mit einer schematischen Zusammenlegung von Gemeinden – wie von der Industriellenvereinigung gefordert – oder von Bezirkshauptmannschaften – wie von der FPÖ forciert – wird man nur bescheidene Einsparungen erzielen, außer man orientiert auf die Privatisierung von öffentlichen Aufgaben und dann soll man das auch klar und deutlich aussprechen.
Denunzierungen des öffentlichen Dienstes, wenn etwa der Industrielle Hannes Androsch von einer „Fettsucht der österreichischen Verwaltungsstrukturen“ spricht, sind der Debatte kaum hilfreich und beleidigen die Beschäftigten. Das Bashing des öffentlichen Dienstes gehört bekanntlich zum Standard-Repertoire der neoliberalen Entsolidarisierung und muss daher mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden.
Solidarität wieder erkämpfen
Wenn wir uns zurückerinnern, wurden und werden seit einem guten Vierteljahrhundert wechselweise die Voestler, EisenbahnerInnen, PostlerInnen, LehrerInnen, Beamte als angeblich Privilegierte von Medien, Politik und Expertentum geprügelt und gegen die übrige Bevölkerung ausgespielt. Die PensionistInnen und Migrantinnen als Draufgabe in Permanenz.
Es entspricht der inneren Logik des neoliberalen Kapitalismus, der unter den Stichworten von „Leistung, Wettbewerb und Konkurrenz“ die Solidarität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt systematisch zerstört. Und dies wird von einem Großteil der Bevölkerung willfährig aufgenommen. Von Menschen, die durch jahrelange Entpolitisierung nicht bereit sind nach oben aufzubegehren, wohl aber nach unten zu treten.
Die Orientierung auf eine solidarische Gesellschaft mit dem Anspruch auf soziale Gerechtigkeit und nach den Grundsätzen „Es ist genug für alle da“ und „Gleiche Rechte für alle“, auf die Wiedererringung von Solidarität ist daher für linke GewerkschafterInnen eine ganz zentrale Anforderung. Dem Motto „In Bewegung kommen - umverteilen!“ gerecht zu werden heißt somit auch für die Solidarität der Lohnabhängigen im gemeinsamen Kampf für ihre ureigensten Rechte für „Gute Arbeit“ und ein „Gutes Leben“ einzutreten.
Es gilt das gesprochene Wort. Zwischentitel redaktionell.