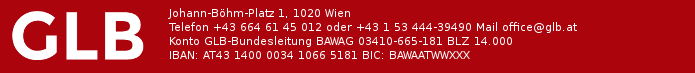Bildung – za wos brauch ma des?
- Mittwoch, 27. Oktober 2010 @ 08:00

 Von Peter Fleissner
Von Peter FleissnerEs ist was faul im Staate Österreich: Die Studierenden an österreichischen Universitäten protestierten im Vorjahr drei Monate lang. Ihr Schlagwort: „Die Uni brennt“ hat zum ersten Jahrestag der Aktion am 19. Oktober eine zweite Protestwelle ausgelöst. Diesmal ging es honoriger zu: Die Rektoren und ProfessorInnen protestierten und demonstrierten mit. Einige wenige Studierende besetzten als Erinnerung an 2009 den großen Hörsaal der Universität Wien. Da im ganzen Land im gewöhnlichen Volk Ruhe und Ordnung sein muss, wurde auf Wunsch des Rektors die Besetzung durch eine Polizeiaktion beendet.
Nach einigen Stunden war alles vorbei. Es beginnt eine neue Runde im mühsamen Marsch durch die Institutionen: Vorsprachen bei der Ministerin, Gespräche mit den BildungssprecherInnen der Parteien, Eingaben der Rektorenkonferenz, alles dazu, dass die Politik statt zu streiten endlich zu Entscheidungen kommt und Nägel mit Köpfen macht.
Mangel an Geld – Mangel an Studierzeit
Worum geht es denn eigentlich? Das erste Problem, mit dem die Universitätsangehörigen kämpfen, ist das Geld. Die Studierendenzahlen haben in den letzten Jahren stark zugenommen, aber die Geldzufuhr ist in etwa gleich geblieben. Im Vergleich dazu gibt etwa die ETH Zürich, eine der angesehensten technischen Universitäten der Welt, pro Studierendem/r etwa zehn Mal so viel aus als die TU Wien.
Da der Personalstand mangels Budget kaum erhöht werden kann, wird die Lehre immer stärker an nicht fest angestellte Lehrkräfte delegiert, die aber schlecht bezahlt sind und kaum über eine unterstützende Infrastruktur verfügen (Sekretariat, TutorInnen, Büro). Oft lehren die DozentInnen ohne finanzielle Zuwendung, einfach nur wegen des aufgebesserten Lebenslaufs, der ihnen vielleicht bei einer späteren externen Bewerbung zu Gute kommen könnte.
Da die Zahl der Lehrkräfte pro Studenten immer kleiner wird, besteht die Betreuung in vielen Fällen kaum mehr als in der Ausstellung eines Zeugnisses. Manche KollegInnen sehen die ProfessorInnen nur in der Vorlesung, wo es aber kaum zu einer echten Diskussion kommen kann, da man sich bei oft hunderten Studierenden im Hörsaal nicht wirklich inhaltlich mit der jeweiligen Problematik auseinandersetzen und ein tieferes Verständnis erwerben kann.
Laut Arbeiterkammer sind derzeit mehr als 60 Prozent der Studierenden berufstätig, 86 Prozent studieren unter dem Jahr ganztags, arbeiten aber während der Ferien. Es wird deutlich, dass die Studierenden kaum mehr genügend Muße haben, sich in die Materie des Studiums einzuarbeiten. Hasardieren bei Prüfungen ist generell üblich. Die Studierenden bereiten sich nicht mehr in hinreichendem Umfang vor, sondern versuchen ihr Glück, auch ohne Lernen bei der Prüfung durchzukommen oder mit anderen Mitteln (Schwindelzettel oder Abschreiben) einen positiven Erfolg zu erreichen. Diese Überlastung hat auch politische Folgen: Ein gesellschaftspolitisches Engagement der Studierenden wird immer schwieriger, da sie dafür einfach keine Zeit haben.
Vermarktungsinteressen im Aufwind
Aber Geld und Zeit sind nicht die einzigen Hürden für den Aufbau eines allen Menschen nützlichen Wissenschaftssystems. Bert Brecht textete in dem Theaterstück „Das Leben des Galilei“ und sprach damit den Studierenden aus der Seele: „Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern.“ Kann man behaupten, dass dieses Zitat eine gute Beschreibung des heutigen Wissenschaftsbetriebs ist?
Der französische Philosoph Lyotard hat mit seinem Werk „Das postmoderne Wissen“ die Zeichen der Zeit ziemlich frühzeitig erkannt und richtig gedeutet. Er meinte, aus dem wissenschaftlichen Diskurs werde die Vielfalt ausgeschlossen und nach irgend einem Maßstab glattgebügelt. Die großen Erzählungen (Glaubenssysteme, politische Ideologien) wurden verändert und durch Begriffe wie „Markt“ und „Globalisierung“ ersetzt. Alles, was keinen Gewinn abwirft, wäre nichts mehr wert. Nicht die Erleichterung der Mühseligkeit des Lebens ist das Ziel des postmodernen Wissens, sondern sein Beitrag zur Profitabilität der weltumspannenden Unternehmen.
Die neoliberale Ideologie stellt die kapitalistischen Interessen als wertfreie Effizienzfragen dar. Effizienz bestehe in der optimalen Anpassung des Bildungssystems an die Erfordernisse der globalisierten Wettbewerbswirtschaft, wie sie die Lissabon-Strategie der EU definiert. Die Universitäten selbst sollten sich in die gesellschaftspolitischen Diskurse einbringen, sollten die Notwendigkeit auch marktfernen Wissens betonen und zu dringenden Problemen der Gegenwart Stellung nehmen. Damit würden sie einen speziellen medialen Platz im Lärm der vielfältigen und modischen Stimmen der Kommerzinformation besetzen können und ihre Bedeutung im Rahmen dieser Gesellschaft stärken.
Wissen für die Lösung gesellschaftlicher Probleme
Die Universitäten hätten dann viel zu tun: Wissenschaftliches Denken, das an den Universitäten und Hochschulen vermittelt wird, sollte nicht auf der Ebene des wertfreien Positivismus steckenbleiben, sondern mit Wertfragen und ethischen Dimensionen zusammengeführt werden. Wissenschaft muss menschlich und emanzipatorisch werden, an Friedenserhaltung, sozialer, ökologischer und geschlechtergerechter Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und nicht bloß an wirtschaftlichen Partikulärinteressen.
Die universitären Lehrstätten sollten prüfen, ob und wie weit Persönlichkeitsbildung (Fähigkeiten zur Kooperation, Selbstkritik, Empathie, Großzügigkeit, Selbstlosigkeit, Perspektivenwechsel, interkulturelle Erfahrungen etc.) im Zuge des Bildungswesens explizit vermittelt werden könnten. Soziale Experimente mit alternativen Arbeits- und Lebensformen auf freiwilliger Basis sollen nicht verhindert, sondern gefördert, durch Begleitforschung professionalisiert und in den Massenmedien verbreitet und zur Diskussion gestellt werden.
Beispiele sind zahlreich: Studienzirkel, regionale Tauschkreise, open source Bewegungen, creative commons, targeted intelligence networks, kooperative Zusammenschlüsse aller Art, solidarische Ökonomien aller Art etc. Wissenschaftliche Texte und Ergebnisse, die mit staatlichen Mitteln erzielt wurden, sollen der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt werden.
Um dies zu gewährleisten, sind von öffentlich finanzierten Universitäten/Hochschulen Informationspools einzurichten, die über das Internet kostenlos zugänglich sind. Private Bildungseinrichtungen können und sollen sich an diesen Pools beteiligen. Institutionen zur Analyse der Technikentwicklung und Technikbewertung sollen eingerichtet werden, die ein umfassendes Bild der Implikationen vor allem neuer Technologien und ihrer gesellschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten und Folgen herauszuarbeiten erlauben. Ihren Ergebnissen sollte in den Massenmedien breiter Raum eingeräumt werden, um Bedürfnisse spezifischer Gruppen zu identifizieren und – wenn technisch machbar – zu befriedigen.
Auch an den gegenwärtigen Problemlagen der Geschlechterkonstruktion könnten sich die Universitäten abarbeiten: Geschlechterverhältnisse strukturieren auch die Universitäten. Trotz des Bekenntnisses von Universitätsleitungen zur Interdisziplinarität wird das Potential der international renommierten Gender Studies nicht ausgeschöpft, sondern eher marginalisiert. Dagegen wäre eine institutionelle Verankerung feministischer Forschung und Lehre in allen Studienrichtungen wünschenswert.
Eine verantwortungsvolle Personalpolitik an den Hochschulen sollte dieser Forderung durch verstärkte Berücksichtigung kritischer feministischer Wissenschaftlerinnen im Stellenplan Rechnung tragen. Die Forderung nach selbstbestimmter Wissensaneignung entgegen elitärer Deutungsmacht ist für Studierende, Lehrende und Forschende gleichermaßen zentral. Im Interesse aller orientiert sie auf einen Aushandlungsprozess selbstbestimmter und demokratischer Strukturen für die Zukunft.
Dies kann nicht ohne die volle Mitbestimmung der größten Gruppe der Universitätsangehörigen passieren, der Studierenden! Selbstverständlich für eine offene, sozial durchlässige und demokratische Universität muss es sein, dass es zu keiner Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sexueller Orientierung, Herkunft, Alter und Menschen mit besonderen Bedürfnissen kommt.
Dies lässt sich in einer strukturell ungleichen Gesellschaft nur durch aktive Arbeit - aktive Frauenförderung durch eine 50-Prozent-Quote, Quoten zur Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund sowie LGBTQ-Personen (lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual, queer) und weiteren Angehörigen systematisch diskriminierter Gruppen in allen Bereichen des Bildungswesens umsetzen.
Gewerkschaften auf der Seite der Studierenden
Die Studierendenbewegung sollte für eine Zusammenarbeit mit allen demokratischen Strömungen und NGOs offen sein. Den Gewerkschaften und dem ÖGB kommt bei der Orientierung auf außeruniversitäre Bündnisse deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sie nach Mitgliederzahl und Einfluss die größten Organisationen abhängig Beschäftigter darstellen.
Gerade das Vordringen prekärer Beschäftigungsverhältnisse an den Universitäten selbst macht heute aber die gewerkschaftliche Interessensvertretung auch zu einer aktuellen inneruniversitären Notwendigkeit. Umgekehrt ist es wichtig, dass breite Kreise der Bevölkerung von außerhalb der universitären Landschaft, den Forderungen der Studierenden und Lehrenden Nachdruck verleihen. Auch sie würden dann in Zukunft von einer fortschrittlichen Universität profitieren können.
Peter Fleissner ist Vorsitzender von transform!at http://transform.or.at