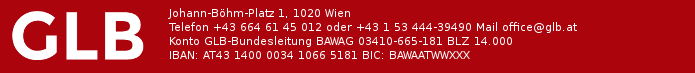Bedürfnisse statt Profit
- Dienstag, 29. Juni 2010 @ 11:36

 Von Leo Furtlehner
Von Leo FurtlehnerIn Afrika sagt man „Die Europäer haben Uhren, wir haben Zeit“. Gut gelaunte Menschen gehen signifikant schneller, depressive Menschen haben einen langsameren Schritt, stellten die Soziologen Maria Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel schon 1933 in ihrer berühmten Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ fest.
Die Zeit spielt in der Debatte um „Gute Arbeit“ eine wesentliche Rolle. Passen die Arbeitsbedingungen, stimmt das Verhältnis zwischen Arbeits- und Freizeit, vergeht sie im Fluge. Hingegen kann schlechte Arbeit zum Totschlagen der Zeit führen, mit Wirkungen weit über den Arbeitsprozess hinaus auf das tägliche Leben. Irrglaube an Selbstlauf
In den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts herrschte der Glaube, dass die Qualität des Arbeitslebens durch den technischen Fortschritt automatisch besser wird. Die damals geführte Debatte um die „Humanisierung der Arbeitswelt“ war (wie auch jene über „Gute Arbeit“ heute) systemstabilisierend als auch systemverändernd zugleich, angesichts des Zusammenhanges von Lohnarbeit und Kapital nicht verwunderlich. Die durch die Trennung von Arbeitsprozess und Eigentum an Produktionsmitteln zwangsläufige Entfremdung (die allerdings auch im ehemaligen Realsozialismus trotz formalen gesellschaftlichem Eigentum nicht überwunden wurde) muss von Lohnabhängigen schließlich irgendwie bewältigt werden, wollen sie nicht vom Frust zerfressen werden.
Die für den Fordismus typische Produktionsweise – charakteristisch dafür war das Fließband – erreichte aber in mehrerer Hinsicht ihre Grenzen. Neues war gefragt, etwa „Lean Production“, selbstbestimmte Gruppenarbeit, Eigenverantwortung. Durch zunehmende Krisenerscheinungen wurde dies freilich bald wieder obsolet. Heute zeigen auffallend viele Selbstmorde in Frankreich oder in China, wohin die Verzweiflung über unerträglichen Leistungsdruck führt. Von der Dunkelziffer der aus „privaten Ursachen“ erklärten Selbstmorde gar nicht zu reden.
Keine Arbeit – zuviel Arbeit
Heute haben wir es immer mehr mit einem schroffen Gegensatz zwischen Menschen die ohne Arbeit sind, ausgegrenzt werden und in Armut abrutschen auf der einen und solchen die „ohne Ende arbeiten“ und permanenter Überforderung bis zur Erschöpfung ausgesetzt sind auf der anderen Seite, zu tun. Deutlicher könnte der inhumane Charakter des Kapitalismus nicht Ausdruck finden als im Aussaugen lebendiger Arbeit durch Verlängerung der Arbeitszeit sowie Intensivierung der Arbeit einerseits und Verdammung zur Untätigkeit verbunden mit ständigem Existenzkampf und als Draufgabe die Denunzierung als „Faulenzer“ oder „Sozialschmarotzer“ andererseits.
Es ist erwiesen, dass Umstrukturierung in Permanenz, für den neoliberalen Kapitalismus und hier wiederum vor allem für bislang staatliche Unternehmen typisch, das Arbeitsklima zerstört. So demoralisiert etwa bei Post und ÖBB die von willigen ManagerInnen im Auftrag dividendengeiler AktionärInnen verordnete Tortur die Beschäftigten.
Solidarität unter Druck
Dabei geraten zunehmend auch Betriebsräte und Personalvertretungen in Gegensatz zu den Menschen die sie vertreten, weil viele aus Angst oft ihnen zustehende arbeits- und sozialrechtlichen Schutz individuell unterlaufen und sich dem Leistungsdruck vorauseilend unterwerfen. Dass dabei auch die Solidarität vor die Hunde geht ist zwangsläufige Folge in einer Gesellschaft, wo Einzelinteressen als Herrschaftsinstrument gezielt propagiert werden.
Dahinter stehen freilich auch politische Vorgaben, die von den Lobbies des Kapitals auf EU-Ebene in Form von Richtlinien beschlossen und von den nationalen Regierungen entsprechend umgesetzt werden.
„Gute Arbeit“ muss alle Facetten umfassen, dabei geht es neben Lohn und Arbeitszeit und Art der Beschäftigung auch um die Gesundheit am Arbeitsplatz und Mitbestimmung. Nur ein geschütztes und geregeltes Arbeitsverhältnis kann „Gute Arbeit“ sicherstellen und ist somit auch Bestandteil eines guten Lebens. Es geht letztlich also darum, Arbeit nach den Bedürfnissen der Menschen zu gestalten und nicht nach dem Profitinteressen der Unternehmen.
Leo Furtlehner ist verantwortlicher Redakteur der „Arbeit“