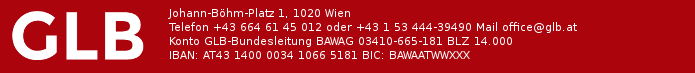Der große Raub
- Dienstag, 20. April 2010 @ 13:14

 Von Gerald Oberansmayr
Von Gerald OberansmayrDie Großindustriellen haben die wachsende Arbeitslosigkeit und die kapitalfreundlichen Rahmenbedingungen seit dem EU-Beitritt zu einem gewaltigen Raubzug an Löhnen und Gehältern genutzt.
Während im Jahrzehnt vor dem EU-Beitritt die Lohnquote nur leicht zurückging, ist sie seither abgestürzt: 1995 betrug der Anteil der ArbeitnehmerInnen-Entgelte (Bruttolohn inkl. Sozialversicherung) 62 Prozent der Bruttowertschöpfung. Dieser Anteil ist bis 2008 auf rund 55 Prozent zurückgegangen. Anders ausgedrückt: Seit dem EU-Beitritt gibt es trotz steigendem BIP für die ArbeitnehmerInnen keine Reallohnsteigerungen mehr. Für manche sogar empfindliche Lohnverluste, denn gleichzeitig geht auch innerhalb der Unselbständig die Schere auseinander. Das unterste Quartil (25 Prozent verdienen weniger, 75 Prozent verdienen mehr) verlor zwischen 1997 und 2006 über 12 Prozent (netto, real); das 1. Quartil der stürzte in diesem Zeitraum gar um über 20 Prozent ab.(1)
Plus 299 Prozent für AktionärInnen
Die Gewinneinkommen stiegen nominal (ohne Inflationsbereinigung) von 1995 bis 2007 um 111 Prozent (zum Vergleich ArbeitnehmerInnen-Einkommen plus 38 Prozent), die Einkommen der Selbständigen um 73 Prozent, und die Ausschüttungen an die AktionärInnen um sensationelle 299 Prozent.
Diese Entwicklung setzt sich auch im Krisenjahr 2008 fort, wie eine Studie der Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und –entwicklung über die Entwicklung der an der Wiener Börse gehandelten Unternehmungen zeigt (2).
Von 2004 bis 2008 vervierfachten sich die Dividenden der ATX-Konzerne von 1,03 Mrd. auf fast vier Milliarden. Selbst im Krisenjahr 2008 wuchsen die Ausschüttungen kräftig, obwohl die Gewinne bereits deutlich zurückgingen. Fazit: 2008 wurden 93 Prozent der Gewinne der ATX-Unternehmen an die Aktionäre weitergereicht.
Ein Rechenexempel
Wie steht dies im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise? Dazu ein Rechenexempel: Wir vergleichen, was die ArbeitnehmerInnen tatsächlich bekommen haben, mit dem was sie erhalten hätten, wenn die Verteilungsverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit von 1995 konstant geblieben wäre.
Das Ergebnis offenbart den bestverhüllten Raub der jüngeren österreichischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Über diese 15 Jahre akkumuliert entsprechen die Lohn- und Gehaltsverluste sage und schreibe 98,3 Milliarden Euro. Das ist mehr als ein Drittel des gesamten BIP von 2008, das den ArbeitnehmerInnen seit dem EU-Beitritt geraubt worden ist. Knapp 57,5 Milliarden davon sind Nettolöhne bzw. -gehälter, also das was den Menschen unmittelbar aus der Brieftasche gezogen wurde. 15,3 Milliarden sind entgangene Lohnsteuer des Staates (die zum Teil über andere Steuern kompensiert wurden) und 25,6 Milliarden sind entgangene Einnahmen der Sozialversicherung, also des Kollektivlohnes der Unselbständigen, um sich gegen die existenziellen Risiken von Krankheit, Unfall, Alter und Arbeitslosigkeit zu schützen.
Das Gezeter um die Unfinanzierbarkeit der Pensionen und des Gesundheitswesens würde sich erübrigen, wenn sich die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit seit 1995 nicht zuungunsten der Letzteren verschoben hätte. Den Krankenkassen soll wegen 1,2 Milliarden Schulden der Rotstift aufgezwungen werden. Aber durch die Umverteilung von Arbeit zu Kapital wurde der Krankenversicherung seit 1995 Geld in der Höhe von 5,2 Milliarden Euro geraubt, also mehr als das Vierfache!
Profitquote steigt
Nun stellt sich die Frage: Sind durch diese enorme Umverteilung von Löhnen zu Gewinnen zumindest die Investitionen entsprechend angekurbelt worden, wie es die neoliberale Dogmatik prophezeit. Mitnichten! Der Anteil der Bruttoinvestitionen an der Wertschöpfung ist von 28,1 (1995) auf 25,4 Prozent (2008) zurückgefallen. Stellt man dasselbe Rechenexempel wie vorhin an, d.h. ermittelt man die Höhe der Investitionen, wenn die Investitionsquote von 1995 konstant geblieben wäre, so errechnet sich in diesem Zeitraum ein akkumulierter Investitionsausfall von fast 45 Milliarden Euro.
Das von der Regierung geschnürte Konjunkturpaket beträgt – großzügig gerechnet – rund drei Milliarden Euro. Die öffentlichen Bruttoinvestitionen haben sich – gemessen am BIP – in diesem Zeitraum sogar halbiert, die öffentlichen Nettoinvestitionen sind sogar negativ geworden, was auf den zunehmenden Verschleiß öffentlicher Infrastrukturen hindeutet (z.B. Stilllegung bzw. Nicht-Erneuerung von Bahnverbindungen, veraltete Schulen).
Wohin ist das Geld also gewandert? Einerseits in den Kapitalexport: Die österreichischen Nettokapitalexporte haben enorm zugenommen, alleine 2008 betrugen die Überschüsse des Kapitalexports über den Kapitalimport über zehn Milliarden Euro. Vielfach fällt darunter die Teilnahme österreichischer Unternehmen und Banken an der fieberhaften Privatisierung öffentlichen Eigentums in Osteuropa, die auch dort keinen Reichtum geschaffen aber viele Menschen arbeitslos gemacht hat.
Ebenso explodierten die Gewinnausschüttungen an die Aktionäre. Die Neoliberalen haben versprochen: Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Tatsächlich hat es sich anders herum verhalten. Die wachsende Ungleichverteilung hat nicht nur die Massenkaufkraft und die sozialen Kassen, sondern auch die realen Investitionsströme ausgetrocknet, sodass zunehmend ein prekärer Wirtschaftskreislauf in Schwung gekommen ist: Luxuskonsum statt Absicherung der Grundbedürfnisse, Spekulation und Privatisierung statt Investitionen in Basisinfrastrukturen. Hier liegen die tieferen Ursachen für die schwere Wirtschaftskrise.
Krisenursachen als Therapie
Im ersten Schock der Wirtschaftskrise haben viele Länder auf lange verschmähte keynesianische Rezepte zurückgegriffen. Staatliche Konjunkturprogramme halfen, das Einknicken der Wirtschaft zu verhindern. Schon das geschah im EU-Raum weitaus unambitionierter als in anderen Regionen. Die Konjunkturpakete im EU-Raum machten gerade einmal ein Prozent des BIP aus, bemerkenswert dürftig im Vergleich mit den USA (5,8 Prozent) oder China (sieben Prozent). Selbst das renommierte Brüssel Breughel-Institut für Wirtschaftsforschung kritisiert die EU-Krisenpolitik als „Potemkinsches Milliarden-Dorf“. Umso ambitionierter aber rufen jetzt – nach der Überwindung des ersten Schocks – Kommission und Zentralbank die EU-Staaten zu einem scharfen Austeritätskurs auf.
Die Kommission hat vielen EU-Staaten, darunter Österreich, mit der Eröffnung von Defizitverfahren die Rute ins Fenster und Österreich ein Sparprogramm von sechs Milliarden Euro bis 2013 verordnet. Schon davor hatte Finanzminister Pröll eine „extrem restriktive Kurs“ beim Staatshaushalt und „Einschnitte so tief wie noch nie“ (3) angekündigt. Unter die Räder dieser Sparpolitik kommen vor allem jene, die auf Leistungen des Sozialstaates und öffentliche Infrastrukturen angewiesen sind. Unterstützung für diese Sparpolitik von EU und Regierung kommt von rechtsaußen. Bereits im Frühjahr 2009 brachte die FPÖ einen Antrag in den Nationalrat ein, der ein Absenken der Staatsquote um vier Prozent – das sind rund zwölf Milliarden Euro – beinhaltete.
Für eine solidarische Wende
Wenn wir aus dieser neoliberalen Sackgasse herauskommen wollen, müssen wir über den Tellerrand des EU-Regimes hinausschauen. Wir brauchen die Umverteilung von oben nach unten, die Stärkung der sozialen Kassen und des öffentlichen Eigentums. Statt Aktionärsportfolios aufzufetten, brauchen wir mehr, und zwar viel mehr Geld für Bildung, Gesundheit, öffentlichen Verkehr, ökologische Energiewende und die Bekämpfung der Armut.
Das ist der Kern einer „solidarischen, ökologischen und demokratischen Wende“, wie sie auch die Werkstatt für Frieden und Solidarität in ihrem Aufruf vorgeschlagen hat (4). Den Kampf um die Durchsetzung müssen wir führen und – bei Strafe sozialer Verwüstungen – gewinnen.
Gerald Oberansmayr ist Vorsitzender der Werkstatt Frieden & Solidarität
Anmerkungen:
(1) Quelle: Statistik Austria, www.statistik.at
(2) ÖGP, wichtige Kennzahlen börsennotierter Unternehmen in Österreich 2004 – 2008, Oktober 2009
(3) Die Presse, 17.2.2009
(4) www.werkstatt.or.at