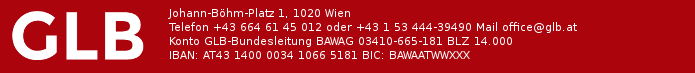Vorrang für gesetzlichen Mindestlohn
- Montag, 8. März 2010 @ 09:51
 Die rasche Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes sieht die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) als dringlichste Maßnahme zur Schließung der enormen Schere zwischen Frauen- und Männereinkommen. Darauf weist GLB-Bundesvorsitzende Karin Antlanger anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März hin und bekräftigt die Forderung des GLB nach zehn Euro Mindestlohn pro Stunde per Gesetz. „Es ist ein Trauerspiel, wenn in Österreich als viertreichstem Land der EU Frauen durchschnittlich um 25,5 Prozent weniger verdienen als Männer und unter den 27 EU-Staaten nur Estland mit 30,3 Prozent und Tschechien mit 26,2 Prozent noch schlechter abschneiden“, kritisiert Antlanger. Laut Eurostat gibt es in 20 der 27 EU-Länder bereits einen solchen gesetzlichen Mindestlohn. So haben mit Österreich vergleichbare Länder wie Luxemburg (1.610 Euro), Irland (1.462 Euro), Niederlande (1.357), Belgien (1.336 Euro) und Frankreich (1.321 Euro) einen solchen gesetzlichen Mindestlohn.
Die rasche Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes sieht die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) als dringlichste Maßnahme zur Schließung der enormen Schere zwischen Frauen- und Männereinkommen. Darauf weist GLB-Bundesvorsitzende Karin Antlanger anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März hin und bekräftigt die Forderung des GLB nach zehn Euro Mindestlohn pro Stunde per Gesetz. „Es ist ein Trauerspiel, wenn in Österreich als viertreichstem Land der EU Frauen durchschnittlich um 25,5 Prozent weniger verdienen als Männer und unter den 27 EU-Staaten nur Estland mit 30,3 Prozent und Tschechien mit 26,2 Prozent noch schlechter abschneiden“, kritisiert Antlanger. Laut Eurostat gibt es in 20 der 27 EU-Länder bereits einen solchen gesetzlichen Mindestlohn. So haben mit Österreich vergleichbare Länder wie Luxemburg (1.610 Euro), Irland (1.462 Euro), Niederlande (1.357), Belgien (1.336 Euro) und Frankreich (1.321 Euro) einen solchen gesetzlichen Mindestlohn.Ein Trauerspiel ist es auch, dass in einigen Branchen wie den bei den Angestellten in Notariaten und bei Rechtsanwälten, ZeitungszustellerInnen, medizinischen MasseurInnen, FußpflegerInnen, KosmetikerInnen und RauchfangkehrerInnen in einigen Bundesländern nicht einmal der von Regierung und Sozialpartnern angestrebte Mindestlohn von tausend Euro brutto – das sind magere 849 Euro netto – realisiert ist.
Der GLB sieht die rasche Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes auch im Zusammenhang mit der Einführung der Mini-Mindestsicherung von 744 Euro (zwölfmal) ab 1. September 2010. Dabei wird nämlich – etwa bei der von Vizekanzler Josef Pröll angezogenen Missbrauchsdebatte – der zu geringe Abstand zwischen Mindestsicherung und Niedriglöhnen beklagt: „Das Problem ist aber nicht, wie die Feinde des Sozialstaates behaupten, eine zu hohe Mindestsicherung, sondern das rasante Wachstum des Niedriglohnsektors“, so Antlanger.
Mit dem von der ÖVP forcierten „Transferkonto“ – das nach Koalitionseinigung nun als „Transparenzdatenbank“ realisiert werden soll – droht zunehmender Druck auf Menschen, die auf eine solche Mindestsicherung existentiell angewiesen sind, weil sie dabei nach dem deutschen Modell von Hartz IV in Billigjobs gedrängt werden. Umso wichtiger ist es daher, durch einen gesetzlichen Mindestlohn dafür zu sorgen, dass zumindest bei Vollzeitarbeit das Einkommen so hoch ist, dass damit das Auskommen gefunden wird und keine Armutsgefährdung droht. Derzeit gelten in Österreich 247.000 Menschen – von denen 129.000 Personen ganzjährig beschäftigt waren und die große Mehrheit Frauen sind – als „working poor".
Als Skandal bezeichnet Antlanger auch, dass durch die Anrechnung des PartnerInneneinkommens bei der Notstandshilfe viele Frauen leer ausgehen, was die Abhängigkeit verstärkt. 2008 haben 14.000 Personen, darunter 12.000 Frauen, dadurch keine Notstandshilfe erhalten. In besonderer Weise werden Frauen auch durch atypische Beschäftigung Opfer der Wirtschaftskrise. Daher ist eine Pflichtversicherung auch für geringfügig Beschäftigte ein Muss. Im Jänner 2010 waren 293.312 Personen, davon 65 Prozent Frauen, geringfügig beschäftigt.