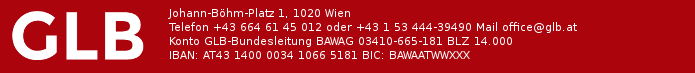Drehen an der Neidspirale
- Donnerstag, 18. Februar 2010 @ 10:07

 Von Gerlinde Grünn
Von Gerlinde GrünnEine Richtschnur zur Beurteilung sozialpolitischer Maßnahmen ist die Fragestellung: Verschlimmern oder verschlechtern Maßnahmen die Lebenssituation von Menschen oder bleibt durch sie alles beim Alten. Und da ist es oft der beste Gradmesser den Blick an die Ränder der Gesellschaft zu werfen. Dorthin wo sich die Widersprüche einer vom Neoliberalismus gekennzeichneten Gesellschaft am schärfsten abzeichnen. Die Fakten sind bekannt. Laut den Zahlen der Armutskonferenz gelten sechs Prozent der österreichischen Bevölkerung als manifest arm. Knapp eine Million der EinwohnerInnen leben unter der Armutsgrenze, sind also mit Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen konfrontiert. Zugewandert, erwerbslos, alleinerziehend oder „working poor“ gelten hier als Risikofaktoren.
Kaum jemand, der an der kalten Zahl des Existenzminimums gemessen als arm gilt, möchte sich selbst als arm bezeichnen; denn arm zu sein heißt in erster Linie Ausschluss aus der Gesellschaft. „Kein Geld, keine Musi“, spricht der Volksmund und er hat recht. Wer als arm gilt, bleibt isoliert, hängt am Gängelband der Armutsverwaltung, ist der Lebensunfähigkeit verdächtig und seiner Zukunftschancen beraubt.
Mit Unbehagen blickt mancher auf diejenigen deren Armut sichtbar wird, auf Obdachlose und BettlerInnen, und nicht immer stellt sich ein Gefühl des Mitgefühls ein, sondern Angst. Angst davor selbst in die Armut abzurutschen oder gar selbst schon zu den Armen zu geh ren. Die Angst vor dem Absturz ist längst in der Mittelschicht angekommen. Nicht mehr nur diejenigen die von Anfang an nicht die besten Startbedingungen haben, sondern auch so mancher Leistungsträger wird durch Jobverlust, Krankheit oder Scheidung aus der Bahn geworfen. Und wer am Boden liegt kommt schwerlich wieder hoch.
Anstatt die richtige Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit zwischen arm und reich zu stellen, wird an der Neidspirale gedreht. Ein medialer Reigen von Neiddiskursen wie Junge gegen Alte, InländerInnen gegen AusländerInnen, LeistungsträgerInnen gegen SozialschmarotzerInnen, Gesunde gegen Kranke, Kinderreiche gegen Kinderlose beschäftigt unter dem Motto „Man stört sich nicht daran, dass nicht alle gleichermaßen am Wohlstand teilhaben, sondern daran, dass es nicht allen gleich schlecht geht.“
Stellvertretend für eine sozialpolitische Maßnahme, die auf dieser Neidbasis fußt, ist das von der ÖVP ins Spiel gebrachte Transferkonto. Ausgehend von der Annahme einer Verteilungsungerechtigkeit von Sozialtransfers zwischen LeistungsträgerInnen und MinderleisterInnen will die ÖVP mittels des Transferkontos, in dem alle Sozialtransfers aufgelistet werden sollen, Transparenz schaffen. Kein Schelm wer böses denkt, denn die ÖVP offenbart auch das Ziel des Ganzen, nämlich die Etablierung eines neuen Prinzips der Leistungsgerechtigkeit, denn Leistung und Arbeit müssen sich laut ÖVP wieder lohnen.
Unschwer zu erkennen, dass es hier wohl letztendlich darum geht die ohnehin schon durchlässigen Maschen des sozialen Netzes weiter aufzuknüpfen. Mit der Unterstellung, dass ein Teil der Bevölkerung namentlich die sozial Schwachen es sich in der sozialen Hängematte gemütlich machen, lässt sich im aufgeheizten Neidklima gut Politik machen. Wer jemals selbst die hochnotpeinlichen Befragung beim Sozialamt oder den Papierkrieg beim Beantragen von Hilfsleistungen hinter sich gebracht hat, weiß, dass es wohl kaum etwas Vermögenstransparenteres gibt als einen Sozialhilfebezieher.
Auch ist es kein Geheimnis, dass die soziale Absicherung in Österreich eng mit der Erwerbstätigkeit verknüpft ist. Ein Großteil der Sozialleistungen sind Versicherungsleistungen, also leistungsgebundene Tranfers. Von einem Gratisschulsystem und Familienbeihilfe profitieren auch Reiche und die Mehrwertssteuer belastet wohl am meisten das schlanke Geldbörserl der Mindestrentnerin.
Das Transferkonto ist also ganz sicher keine sozialpolitische Maßnahme die zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen beiträgt. Das gemeinsame Nachdenken darüber, wie eine solidarische Gesellschaft jenseits von Leistungszwang und Ausschlüssen unter der Prämisse es ist genug für alle da funktionieren könnte ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
Gerlinde Grünn ist Sozialpädagogin und KPÖ-Gemeinderätin in Linz