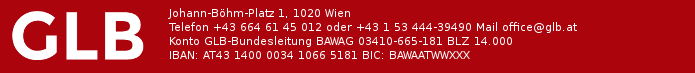Gewerkschaftspolitik unter den Bedingungen des Neoliberalismus
- Samstag, 23. Juni 2007 @ 16:43

 Von Alexandra Weiss Alexandra, Politologin und freie Wissenschafterin, derzeit im Büro für Gleichstellung und Gender Studies der Universität Innsbruck tätig und Lektorin an verschiedenen Universitätsinstituten und Fachhochschulen, Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Emanzipation und Partnerschaft und der Michael-Gaismair-Gesellschaft
Von Alexandra Weiss Alexandra, Politologin und freie Wissenschafterin, derzeit im Büro für Gleichstellung und Gender Studies der Universität Innsbruck tätig und Lektorin an verschiedenen Universitätsinstituten und Fachhochschulen, Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Emanzipation und Partnerschaft und der Michael-Gaismair-Gesellschaft„Eigenverantwortung“ als Begriff ist eines jener Worte, mit dem heute eine Politik der Verunsicherung gemacht wird. Denn Eigenverantwortung an sich ist ja ein positiver Begriff, der eigenständiges Handeln, die Verantwortlichkeit dafür, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und in diesem Sinn Freiheit bezeichnet oder bezeichnen kann. Was meint aber der Begriff der Eigenverantwortung und Freiheit heute, im Zuge der neoliberalen Umformung von Ökonomie, Politik und Gesellschaft? Er ist vor allem zu verstehen als Kampfansage an den Sozialstaat, an Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit und Gleichheit werden denunziert als Prinzipien des Sozialstaates der damit „Gleichmacherei“, „Bevormundung“ und „Verweichlichung“, mache würden sagen „Verweiblichung“, der Gesellschaft und des Staates eingeleitet hat.
Vergessen wird dabei: Wo immer Menschen für Freiheit gekämpft haben, haben sie den Weg dazu gleichzeitig immer auch mit sozialer Gleichheit bzw. dem Kampf gegen Privilegien verbunden. Der französische Theoretiker Etienne Balibar hat deshalb den Begriff der Gleichfreiheit (egaliberté) vorgeschlagen – denn in der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ von 1789 werden diese beiden Begriffe, so Balibar (1993, 107), für identisch erklärt: „Jeder ist genau das ‚Maß’ des andren.“
Heute wird von einer voraussetzungslosen Freiheit ausgegangen. Eine Freiheit ohne Gleichheit ist aber keine Freiheit oder sie ist nur eine Freiheit für wenige bzw. für jene, die Freiheit nicht jenseits ökonomischer Macht verstehen können. Diese Freiheit ist nicht mehr verbunden mit einer Vision über die Gesellschaft und wie Menschen zusammen leben sollen. Es ist eine asoziale bezugslose Freiheit, die vielmehr egoistische Vorteile für wenige meint.
Nun ist der Sozialstaat einmal angetreten, wenn schon nicht eine gesellschaftliche Utopie umzusetzen, so doch zumindest ein gewisses Maß an Gleichheit und allgemeiner Teilhabe herzustellen. Aber selbstverständlich waren auch hier nicht alle gemeint. Wie nun dieser sozialstaatliche geformte Kapitalismus aussah, wie er umgeformt wird und welche Bedeutung dies für gewerkschaftliche Politik hat, soll im Folgenden ausgeführt werden.
1. Fordismus: Soziale Gerechtigkeit als männliches Projekt?
Die Nachkriegsjahrzehnte werden als Zeit des „gebändigten Kapitalismus“ bezeichnet, die eine Ausnahme in der Geschichte und Entwicklung des kapitalistischen Wirtschaftssystems darstellen, die als Abfolge struktureller Krisen analysiert wird. Die Lösung bestand in der Nachkriegszeit in der Durchsetzung einer spezifischen ökonomischen Akkumulations- und politisch-sozialen Regulationsweise: dem Fordismus1 (Hirsch 1998). Mit der Durchsetzung tayloristischer Massenproduktion2 und dem damit einhergehenden Massenkonsum konnte eine strukturelle Verbesserung der Profitabilität des Kapitals durchgesetzt werden. Damit ging eine politisch-soziale Regulationsweise einher, die durch einen hohen Grad an staatlicher Wirtschaftssteuerung, den Ausbau einer staatsinterventionistischen Wachstums-, Einkommens- und Beschäftigungspolitik, die Anerkennung der Gewerkschaften, die Institutionalisierung des Klassenkompromisses im Rahmen korporatistischer Systeme3 und die Verallgemeinerung einer spezifischen Lebensform, der Kleinfamilie, charakterisiert ist (vgl. Hirsch 1998, 19-20). Theoretische Grundlage dieser Wirtschafts- und Sozialpolitik war der Keynesianismus, der in den Nachkriegsjahrzehnten in allen westlichen Industrienationen bestimmend war und mit dem auch der Ausbau des Sozialstaates wesentlich zusammenhing (vgl. Scharpf 1987).
Der fordistische Staat ging also erstmals mit einer Inklusion der Arbeiterklasse einher und mit einer Integration der Reproduktion der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Verwertungszusammenhang. Der Staat wird damit ein Staat des gesamten Volkes (Buci-Glucksman/Therborn 1982, 119). Ansprüche auf mehr Lohn, kürzere Arbeitszeiten und mehr Freizeit mussten so nicht mehr abgewehrt werden, sondern waren vielmehr Grundlage kapitalistischer Entwicklung. Denn wie Henry Ford richtig sagte: „Autos kaufen keine Autos.“ Massenproduktion muss Massenkonsum gegenüberstehen.
Dazu gehört auch der in den Nachkriegsjahrzehnten eingeleitete Ausbau des Sozialstaates, der nach und nach beinahe die gesamte Bevölkerung erfasste. Der Anteil der durch die Sozialversicherung geschützten Personen stieg in Österreich – vor allem durch die Mitversicherung von Familienangehörigen – von 66 Prozent im Jahr 1946 auf 96 Prozent im Jahr 1980 und erreichte damit fast das Niveau einer Volksversicherung (vgl. Tálos/Wörister 1994, 37). Der Sozialstaat hatte aber von Beginn an eine geschlechtsspezifische „Schlagseite“. Nachholende Reformen in den 1970er und 1980er Jahren konnten dies nur ansatzweise ausgleichen.
Alle Sozialstaatsmodelle sind mehr oder weniger erwerbszentriert und benachteiligen daher Frauen, die überwiegend die unbezahlte Arbeit im Haus, in der Kindererziehung und in der Pflege verrichten. Die Ursache für die strukturelle Diskriminierung von Frauen liegt darin, dass die modernen Sozialstaaten das Alleinverdiener/Hausfrauen-Familienmodell bevorzugt und unterstützt haben (vgl. Appelt 1999, 97-98).
Hintergrund dessen ist, dass der historische Ausgangspunkt des Sozialstaates die „soziale Frage“ des 19. Jahrhunderts war, die mit der „Arbeiterfrage“ identisch und im Wesentlichen als „Männerfrage“ konzipiert war.4 Schon seit ihren Anfängen ist die Position der Arbeiterbewegung und Gewerkschaften zur Erwerbstätigkeit von Frauen von einer tiefen Ambivalenz geprägt. Die tatsächliche Konkurrenz aufgrund der niedrigeren Frauenlöhne5, die Angst um Arbeitsplätze, gepaart mit der Infiltration v.a. der relativ qualifizierten lohnabhängigen Männer – der ‚Kernschicht’ der entstehenden Arbeiterbewegung – mit einem bürgerlichen Familien- und Frauenbild, waren Anlass für massive Ausschlusstendenzen schon in der entstehenden Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts (vgl. Hauch 1991, 64).
Die aus dieser Haltung resultierende Konsequenz war eine Politik, die Ressentiments gegen Frauen schürte und sie als „Lohndrückerinnen“ diffamierte. Frauen – und nicht Kapitalinteressen – erschienen so als Bedrohung erworbener oder noch zu erkämpfender Rechte. Diese historische Haltung der Gewerkschaften bleibt bis heute prägend und beeinflusste auch die Ausgestaltung des Sozialstaates. Ausdruck dafür ist unter anderem, dass eine Politik der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt nie ernsthaft betrieben wurde beziehungsweise an eine gesonderte Frauenabteilung delegiert wurde, die an den zentralen sozialpartnerschaftlichen Aushandlungsprozessen nicht beteiligt war. Die Machtlosigkeit von Frauen in den Gewerkschaften hat seinen Ursprung gerade in der gesonderten Organisierung von Fraueninteressen in den so genannten „Frauenabteilungen“, die selten in die Zentren der gewerkschaftlichen Gremien vordringen, und spiegelt sich im sozial-partnerschaftlichen System wider (vgl. Neyer 1997, 69-71).
Gewerkschaften erweisen sich als „Männerbünde“ (vgl. Kreisky 1994), indem sie partikulare männliche Interessen durch politische Allianzen verallgemeinern und diese so als allgemeine Interessen der ArbeiterInnenschaft postulieren können. Den kollektiven Interessen von Männern wird über die Einbindung der Gewerkschaften in korporatistische Systeme (in Österreich des Österreichischen Gewerkschaftsbundes in die Sozialpartnerschaft) und in das politische System die Möglichkeit eingeräumt, die Inhalte von Politik und damit auch die Ausgestaltung von Geschlechterverhältnissen mitzubestimmen. Fraueninteressen und Frauenarbeit werden in diesen Zusammenhängen im politischen Diskurs zum Verschwinden gebracht und ins Private abgeschoben. Was sind aber die Ursachen für frauenausschliessende Mechanismen und dafür, dass grundlegende gesellschaftliche Widersprüche nicht erfasst werden?
Einer der wesentlichen Gründe liegt in den theoretischen Grundlagen der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung, in denen Frauenarbeit – bezahlte als auch unbezahlte – wenig Beachtung geschenkt wurde oder nur im Zusammenhang mit der Veränderung der Arbeit und der Arbeitsverhältnisse durch die Industrialisierung vorkommt (vgl. Marx 1957 [1867], 251-259).6 Frauen finden weder in ihrer Rolle als (Industrie-)Arbeiterinnen und noch weniger in der als Hausarbeiterinnen Erwähnung oder gar Anerkennung. Der Bereich der materiellen Reproduktion wird in der klassischen marxistischen Theorie hintangestellt und so der überwiegende Teil der Frauenarbeit nicht in ökonomischen Kategorien analysiert. Die weitgehende Reduktion der Theorie auf die Bereiche der Lohnarbeit und der Produktion wiederholt die Trennung der öffentlichen und der privaten Sphäre – ganz im Sinne der bürgerlich- liberalen Theorie – und verstellt damit nicht nur den Blick auf die Konstituierung herrschaftlicher Geschlechterverhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch auf die spezifische Funktionsweise kapitalistischer Produktion (vgl. Ivekovic 1984). Ein anderer Grund liegt in der Ausprägung eines „proletarischen Patriarchalismus“ in der entstehenden Arbeiterbewegung, der sich hinsichtlich der Wohlfahrt der ArbeiterInnenschaft an einem verallgemeinerten bürgerlichen Familienmodell orientierte (vgl. Weiss 2004).
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die Politik der Gewerkschaft (nach wie vor) von dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit geprägt ist, die Widersprüche zwischen nicht entlohnter Arbeit, Lohnarbeit und Kapital jedoch ausgeblendet bleiben (vgl. Neyer 1997, 71-73). Nichtbezahlte Arbeit verschwindet so aus dem politischen Diskurs; hierarchische Geschlechterverhältnisse werden damit politisch abgesichert. Daraus ergibt sich schließlich die Zweigeteiltheit der sozialstaatlichen Ansprüche in jene, die aus der Lohnarbeit resultieren und auf Männer zugeschnitten sind und jene, die abgeleitet oder subsidiär bestehen, wie etwa an der Mitversicherung von Familienangehörigen in der Krankenversicherung deutlich wird (vgl. Kreisky 1995, 212; Cyba 2000, 253). Frauen werden in Bezug auf ihre soziale Sicherheit auf den Ehevertrag verwiesen, also auf ein privates Abhängigkeitsverhältnis. Die Absicherung von Reproduktionsarbeit ist im Sozialstaat nicht vorgesehen, Erziehungs-, Betreuungs- und Hausarbeit wird so der Charakter von gesellschaftlich nicht relevanter Arbeit verliehen.
Diese Anknüpfung von Gewerkschaften und Arbeiterbewegung an ein bürgerliches Familienideal hatte für Frauenarbeit fatale Konsequenzen: die Abwertung von Frauenarbeit, ihre Definition als „Zuarbeit“ und die Doppelbelastung durch die alleinige Verantwortung für die reproduktive Arbeit, die als „Nicht-Arbeit“ definiert wird. Das Nachvollziehen der Unterscheidung von Frauenarbeit (= unqualifiziert) und Männerarbeit (= qualifiziert) mit den entsprechenden Konsequenzen etwa auf die Entlohnung, die Qualität der Arbeitsverhältnisse, erwies sich dabei als doppelt schädlich. Frigga Haug (1996, 169-170) führt aus, dass etwa im Zuge der Automatisierung der Arbeit, „Männer“- in „Frauenarbeitsplätze“, also „unqualifizierte“ Arbeitsplätze, umdefiniert wurden. Die Definition von Frauenarbeit als unqualifizierte Arbeit, auch durch Gewerkschaften, führte zum einen zu einer Frontstellung von Männern gegenüber Frauen7, zum anderen werden durch zunehmende Automatisierung immer mehr Arbeitsplätze „unqualifizierte“, schlecht bezahlte „Frauenarbeitsplätze“, auf denen auch immer mehr Männer arbeiten. Resultat dieser kurzsichtigen Politik ist ein allgemeines Absenken der Lohniveaus, das auch Männer trifft und den von Gewerkschaften eingeforderten Familienerhalterlohn – ohne Ausgleich auf Seiten der Frauen – beseitigt.
Unabhängige Existenz und materielle (auch sozialstaatliche) Absicherung sind so vorwiegend für den männlichen Normalarbeiter vorgesehen und möglich. Frauen wurden in diesem System nicht als autonome Individuen, sondern im Rahmen der Familie und ihrer Aufgaben dort verortet. Der Sozialstaat – als Kompromiss zwischen Männern – hat dieses Modell festgeschrieben und in diesem Sinn geht die Entwicklung des Sozialstaates im fordistischen Kapitalismus für Frauen – vorerst – mit einer „Hausfrauisierung“ einher.
Wir haben nun gesehen, dass sich soziale, politische und ökonomische Regulierungen im Fordismus vorrangig an männlichen Bedürfnissen orientierten. Da die Macht zu definieren, was als Bedürfnis zu gelten hat, wie es zu interpretieren und in sozialpolitische Leistungen zu übersetzen ist, bei männerbündischen Interessenorganisationen lag, wurden Fraueninteressen als „privat“ aus dem politischen Raum ausgeschlossen. Die zweite Frauenbewegung kritisierte diese Denkweise und setzte mit ihrem Slogan Das Private ist politisch! vor allem die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt, (sexuelle) Gewalt gegen Frauen, die einengenden Strukturen der Kleinfamilie und die vielfältigen Verflechtungen dieser Unterdrückungsmechanismen auf die politische Tagesordnung. Herrschaftliche Geschlechterverhältnisse wurden auch als (sozial-)staatlich regulierte Verhältnisse analysiert und damit ihrer scheinbaren Natürlichkeit beraubt. Mit dieser Kritik kommt auch der unterschiedliche Status von Frauen und Männern als StaatsbürgerInnen in den Blick. Waren der Sozialstaat und die Frage sozialer Rechte bisher um die Klassenfrage zentriert, so geht es nun auch um die unterschiedliche Behandlung von Frauen und Männern hinsichtlich Arbeit, Reproduktion, Körper und Sexualität.
Auch wenn es vielen so scheinen mag, dass diese Fragen nichts mit den Kernfragen einer Arbeiter- oder Gewerkschaftsbewegung oder mit Sozialpolitik zu tun haben, stelle ich dem hier entgegen, dass auch eine gewerkschaftliche Frauen- und Geschlechterpolitik nicht daran vorbei kommen kann, dass Frauen sich als politische Wesen, in öffentlichen Raum nicht frei bewegen können, wie Männer. Immer sind sie damit konfrontiert, als Sexualobjekte betrachtet, auf ihren Körper reduziert zu werden und potentiellen Angriffen auf ihre sexuelle und körperliche Integrität ausgesetzt zu sein. Das beeinträchtigt den Zugang zur und die Artikulation in der öffentlichen Sphäre oder konkreter gesprochen – politischen und gewerkschaftlichen Gremien und zur Berufsarbeit. In den Gewerkschaften, mit einer extrem stark ausgeprägten männlichen Kultur, führt dies u.a. nicht zuletzt auch zu einem recht geringen Organisierungsgrad von Frauen.
Durch den Druck der neuen Frauenbewegung und internationale Trends8 kam es in den 1970er Jahren schließlich zu geschlechterpolitischen Reformen: 1975 wurde die Fristenregelung eingeführt, 1976 wurde das patriarchale Familien- und Eherecht durch ein partnerschaftlicheres ersetzt; 1979 wurde das – 1985 novellierte und erweiterte – Gesetz über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Festsetzung des Entgeltes beschlossen. (vgl. Tálos/Falkner 1992, 207-210; vgl. Münz/Neyer 1986).
Das geschlechterpolitische Arrangement des Fordismus – auf dem auch der Sozialstaat basierte –, das von einer männlichen Vollerwerbstätigkeit und der allenfalls marginalen Arbeitsmarktintegration von Frauen ausging, wurde aber bereits in den 1970er Jahren brüchig. Die Frauenerwerbsquote ist im Laufe der 1970er Jahre gestiegen: 1962: 37 Prozent, 1972 38 Prozent, 1983 40,4 Prozent. Die Zahl weiblicher Erwerbstätiger (plus 25 Prozent) stieg zwischen 1970 und 1980 auch stärker als die der Männer (plus 11 Prozent) (vgl. Pelz 1986, 86-88).
Trotz dieser Entwicklungen und politischer Maßnahmen blieb doch eine politische, sozialstaatliche und kulturelle Absicherung herrschaftlicher Geschlechterverhältnisse bestehen. Überdies wurden weiterreichende Reformen durch die wirtschaftliche Rezession und den darauf folgenden Angriff auf den Sozialstaat im Ansatz erstickt. Die staatliche Geschlechterpolitik konzentrierte sich ab den 1980er Jahren mehr und mehr auf eine rechtliche Gleichstellungspolitik, die für viele Frauen, insbesondere in gering qualifizierten Bereichen, wenig Relevanz besaß. Materielle Interessen und Umverteilungspolitik wurden zunehmend in den Hintergrund gedrängt.
2. Postfordismus: Deregulierung und Sozialstaatsabbau
Ende der 1970er Jahre zeichnete sich eine Krise des fordistischen Akkumulationsmodells9 ab, die auch eine Krise des Sozialstaates einleitete. Die Vereinbarkeit von Kapitalprofit und Massenwohlfahrt war nicht mehr gegeben und damit wurde auch die Grundlage für den so genannten Klassenkompromiss – in Österreich institutionalisiert in der Sozialpartnerschaft – brüchig. Der Fall der Profitraten, angezeigt durch eine Verlangsamung des Produktivitätswachstums, der Anstieg der Gesamtkosten der Arbeit (einschließlich der indirekten Löhne des Sozialstaates) und ein Anstieg der Rohstoffpreise gelten als Auslöser der Krise (vgl. Leborgne/Lipietz 1996, 698). Der Sozialstaat mit seinem umfassenden Leistungssystem hätte in dieser Situation nur durch eine stärkere Umverteilung von oben nach unten gewährleistet werden können, stattdessen wurde der Klassenkompromiss einseitig aufgekündigt. Ideologisch verarbeitet wurde die Demontage des Sozialstaates mit Parolen wie Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt oder Der Sozialstaat ist in Zeiten wirtschaftlicher Krisen nicht mehr finanzierbar.
Vor diesem Hintergrund fand auch ein Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik statt: von einer keynesianischen (nachfrageorientierten) hin zu einer monetaristischen (angebotsorientierten) Wirtschaftspolitik. Grundaussage des Monetarismus ist, dass der Kapitalismus an sich nicht krisenanfällig sei, für Krisen verantwortlich sei allenfalls eine falsche Fiskalpolitik der Regierungen oder eine falsche Geldpolitik der Zentralbanken. Entsprechend der neuen wirtschaftspolitischen Ausrichtung sollte das kapitalistische System einfach seinen eigenen Mechanismen überlassen werden (vgl. Senf 2001, 249-250, 254).
Grundsätzlich beruht der Monetarismus auf einer sehr abstrakten Vorstellung des Marktgeschehens. Gesellschaft und Politik erscheinen als Störfaktoren, deren Einfluss auf die Ökonomie es zu minimieren gilt. Als Ideal gilt im Monetarismus ja auch der so genannte Gleichgewichtslohn, der sich nach Angebot und Nachfrage einpendeln soll. Insbesondere Gewerkschaften gelten da als Hemmnis der ökonomischen Entwicklung, verzerren sie doch das natürliche Einpendeln der Preise – auch für die Ware Arbeitskraft. Darüber hinaus wird ein gewisses Ausmaß an Arbeitslosigkeit als rational betrachtet – weil es die Löhne gering hält.
Der Markt wird aber auch als geschlechtsneutral konstruiert. Märkte sind aber soziale Interaktionen und basieren auf gesellschaftlichen Normen und Institutionen. Sie sind also keine ‚natürlichen’ Sphären, wie dies die Neoklassik postuliert, sondern sie sind herrschaftlich durchtränkt und sie haben hierarchische Klassen- und Geschlechterverhältnisse zur Grundlage (Sauer 2003, 103). Zentral ist dabei wiederum die Trennung von Produktion und Reproduktion, die der traditionellen geschlechtlichen Arbeitsteilung folgt und reproduktive Arbeit entwertet. Überdies wird im Zuge neoliberaler Politik die im Fordismus ansatzweise realisierte Vergesellschaftung von Reproduktionsarbeit sukzessive wieder zurückgenommen.
Die vom Monetarismus propagierten Reformen bestehen vor allem im Abbau des staatlichen Haushaltsdefizits und einer Verminderung der Geldschöpfung, was mit dem Ende keynesianischer Nachfragepolitik einherging, das heißt, dass Staatsausgaben – hier stehen in erster Linie sozialstaatliche Ausgaben zur Diskussion – sowie Lohn- und Lohnnebenkosten reduziert werden sollen. Wenn von der Nachfrageseite (durch Konsum) her die Gewinnmöglichkeiten der Unternehmen eingeschränkt werden, müssen von der Angebots- bzw. Kostenseite her neue Bedingungen geschaffen werden. Realisiert werden die geforderten Kostensenkungen vor allem im Bereich der Arbeitskosten, der Steuern oder der Umweltschutzkosten (vgl. Senf 2001, 256-258).
Heiner Ganßmann (2001, 51) stellt etwa fest, dass das primäre Kriterium der Steuerlastenverteilung nicht mehr die Belastung nach Leistungsfähigkeit10, sondern die Unfähigkeit zur Steuervermeidung ist. Das bedeutet, dass sich eine Wende hin zu einer stärkeren Belastung der abhängig Beschäftigten vollzogen hat, die der Steuerbelastung schlechter ausweichen können. Ein internationaler Vergleich zeigt, dass in Österreich der Faktor Arbeit überdurchschnittlich hoch besteuert wird. Zu den aufkommensstärksten Steuern zählt 2005 neben der Umsatzsteuer mit 33,9 Prozent die Lohnsteuer mit 30,2 Prozent. Die Besteuerung von Vermögen ist in Österreich (in Prozent des Gesamtaufkommens im Jahr 2003) hingegen mit 1,3 Prozent unterdurchschnittlich (2003 Deutschland: 2,4 Prozent, Großbritannien: 11,8 Prozent, Frankreich: 7,3 Prozent, USA: 12,2 Prozent des Gesamtaufkommens) (vgl. Lunzer 2006, 20-23). Bereits Mitte der 1990er Jahre betrug das Aufkommen an Vermögenssteuern11 in Österreich nur mehr 1,6 Prozent des gesamten Abgabenaufkommens. Österreich bildet damit das Schlusslicht unter den OECD- Ländern und erweist sich als Steueroase für VermögensbesitzerInnen (vgl. Predel 1998, 44-45). Die gesamte Abgabenlast für unselbstständige Arbeit steigt in Österreich hingegen rasant und liegt mit 40,5 Prozent im Jahr 2003 über dem EU-Durchschnitt. Die regressive Wirkung der Sozialversicherungsbeiträge und der hohe Anteil der ebenfalls regressiven Umsatz- und Verbrauchssteuern am Abgabenaufkommen führen dazu, dass das österreichische Steuersystem praktisch keine Progressivität aufweist (vgl. Watch Group 2006, 28-29). Dem Prinzip der Leistungsfähigkeit wird damit immer weniger entsprochen und die damit verbundenen Verteilungseffekte – zuungunsten abhängig Beschäftigter und geringer Einkommen – werden kaum noch diskutiert.
Die Senkung der Arbeitskosten erfolgt im Wesentlichen über die Etablierung neuer Beschäftigungsformen. Direkte Kostenvorteile für Unternehmen sind etwa das Wegfallen von Kündigungskosten bei befristeten Beschäftigten, LeiharbeiterInnen oder arbeitnehmerähnlichen Scheinselbstständigen. Andere Bestandteile der Lohnkosten wie Sozialversicherungsbeiträge fallen meist in einem geringeren Ausmaß an, als bei Normalarbeitsverhältnissen. Darüber hinaus bestehen überdurchschnittlich oft kein tarifvertraglich festgesetzter Mindestlohn und oft auch kein Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder auf Urlaubsgeld (vgl. Fink 2000, 402).
Durch das Zunehmen von atypischer Beschäftigung und die gleichzeitig steigende Arbeitslosigkeit reduzieren sich aber die Sozialversicherungsbeiträge im System der sozialen Sicherung. Dies verstärkt den Druck auf den Sozialstaat und die Beschäftigten, die sich zunehmend gezwungen sehen, Arbeit „zu jeder Bedingung“ zu akzeptieren. Das Ansteigen der Frauenerwerbstätigkeit ist vor diesem Hintergrund eine zwiespältige Entwicklung, hat sich doch in den letzten Jahren nu r die Zahl der Arbeitsplätze von Frauen erhöht und nicht deren Beschäftigungsvolumen. Seit 1985 und insbesondere seit Mitte der 1990er Jahre bestehen die Zuwächse in der Frauenbeschäftigung überwiegend aus zeitlich reduzierten Arbeitsverhältnissen. Erwerbsarbeit wird also nicht zwischen Männern und Frauen, sondern nur zwischen Frauen umverteilt. Dadurch wird die Rolle der Frauen als „Zuverdienerinnen“ zementiert und eine neue, zusätzliche Segregation zwischen Frauen und Männern etabliert, und zwar nach Arbeitsformen bzw. - verträgen (vgl. Rosenberger 2000, 421-422). Insbesondere im Zusammenhang mit der Ausdehnung des Dienstleistungssektors kommt es zu einem Ansteigen der Teilzeitbeschäftigung. In Österreich lag die Teilzeitquote 2004 mit 20,2 Prozent über dem EU-15-Durchschnitt von 19,4 Prozent. Es ist aber nicht nur der Anteil der Teilzeit höher, auch der Zuwachs hat sich schneller vollzogen als in anderen europäischen Ländern:
1995 lag deren Anteil noch bei 13,9 Prozent, während die EU-15 bei 16 Prozent lagen. Überdies ist anzumerken, dass sich diese Beschäftigungsform in Österreich wesentlich stärker auf Frauen konzentriert: 2004 waren im EU-15-Durchschnitt 31,4 Prozent der beschäftigten Frauen in Teilzeitbeschäftigungen, in Österreich hingegen bereits 38,7 Prozent. So hat sich zwar die Beschäftigung von Frauen erhöht, das Arbeitsvolumen ist allerdings nicht gestiegen, es ist teilweise sogar zurückgegangen. Gemessen in Vollzeitäquivalenten ist die Beschäftigungsquote seit 1995 (53,4 Prozent) sogar gesunken und liegt 2004 bei 49 Prozent (vgl. Kammer für Arbeiter und Angestellte 2006, 17-18). Diese Entwicklung hängt natürlich auch mit der Situation in der vor- und außerschulischen Kinderbetreuung in Österreich zusammen. Dramatisch gestiegen ist auch der Anteil der geringfügig beschäftigten Personen. Waren es 1996 noch 148.803 Personen, so waren es 2004 bereits 222.906; rund 70 Prozent davon sind Frauen (vgl. ebd., 19).
Wir haben es also mit einer Ausdifferenzierungen von Beschäftigungsverhältnissen und eine Zunahme von Arbeitsverhältnissen zu tun, die keine oder nur eine marginale soziale Absicherung garantieren. Festzuhalten ist auch, dass mit der massiven Zunahme der Teilzeit- und atypischen Beschäftigungen eine reale Arbeitszeitverkürzung, aber keine kollektivvertraglich geregelte, stattfindet. Das bedeutet, dass die Produktivitätssteigerungen der letzten drei Jahrzehnte – auch aufgrund der geschwächten Position der Gewerkschaften – zwar mit Arbeitszeitverkürzung12 einhergingen, allerdings ohne Lohnausgleich. Umverteilungsmechanismen zugunsten unterer Schichten wurden außer Kraft gesetzt.
Die Arbeitsmarktintegration von Frauen geschieht also vor dem Hintergrund einer Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen und der Ausdehnung des informellen Sektors mit gänzlich ungeschützten Beschäftigungsformen (vgl. Sauer 2001, 71-72; Young 1998, 147). Ansprüche auf volle soziale Absicherung können mitunter gar nicht mehr erworben werden oder nur in einem Ausmaß, das weit von einer Existenzsicherung entfernt ist. Als „Spätfolge“ ist mit einem Anstieg der Altersarmut vor allem bei Frauen zu rechnen.13
Die neoliberale Neustrukturierung der Arbeit geht so mit einer Differenzierung von Beschäftigungsverhältnissen einher. Beschäftigungspraktiken sind ein Mittel (geworden), um den Status der Beschäftigten neu zu bestimmen und damit Spaltungen quer durch diese Gruppe hervorzutreiben. Geschlechtsspezifische Differenzierungen und Abhängigkeiten werden verstärkt, da die finanzielle Basis von Autonomie durch atypische Beschäftigungen kaum gewährleistet ist (vgl. Jenson 1997, 240). Gerade in Hinblick auf die Neustrukturierung der Arbeit werden aber auch Spaltungen zwischen Frauen verschiedener Klassen und Ethnien deutlicher. Nicht alle Frauen sind im Niedriglohn- und atypischen Segment angesiedelt, genauso wenig, wie alle Männer auf Seiten der Globalisierungsgewinner stehen. Einige qualifizierte Frauen haben den Einstieg in hoch qualifizierte und hoch dotierte Jobs geschafft, auch wenn sie durch eine „gläserne Decke“ gebremst werden. Da aber Frauen grundsätzlich weiterhin für den Reproduktionsbereich zuständig bleiben und sich ein Mehr an Geschlechtergerechtigkeit nicht durch eine gerechte Aufteilung der Versorgungsarbeit realisiert, sondern durch Auslagerung dieser Arbeit, kommt es zur Herausbildung eines internationalen – vorwiegend weiblichen – „DienstbotInnenpersonals“ (vgl. Young 1998, 138-139; Bakker 1997, 69; Sauer 2001, 72).
3. Konsequenzen und Perspektiven
Wie die obigen Ausführungen gezeigt haben, geht der Globalisierungsprozess mit einer teilweisen Herauslösung ökonomischer Prozesse aus sozialen und politischen Bindungen einher. Der Übergang vom „Sicherheitsstaat“ zum „Wettbewerbsstaat“ (Hirsch 1998) bedeutet eine Absage an die Vollbeschäftigungspolitik und soziale Sicherheit für breite Schichten der Bevölkerung.
Globalisierung oder Internationalisierung stellen die Gewerkschaften vor allem in den westlichen Industrienationen vor wachsende Probleme. Die Arbeitgeberseite ist beweglicher geworden: wenn ihr etwa Unternehmenssteuern oder arbeits- und sozialrechtliche Schutzbestimmungen inakzeptable erscheinen, können sie leichter aus den nationalen Zusammenhängen aussteigen und Produktionsstandorte verlagern (Blaschke 2002, 89). Auch wenn die Standortverlagerung hauptsächlich als Drohung eingesetzt wird, so ist sie doch zunehmend eine reale Möglichkeit geworden und ein politisch äußerst wirksames Mittel um Gewerkschaften und Staat unter Druck zu setzten (vgl. Ganßmann 2001, 60-61). Verschärft wird der Machtverlust der Gewerkschaften noch durch die relativ hohe Arbeitslosigkeit. Die größere Beweglichkeit des Kapitals schränkt auch die Möglichkeiten der Gewerkschaften ein, Einfluss auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik zu nehmen (Blaschke 2002, 89).
Die Sozialpartnerschaft bzw. die österreichische Variante des Klassenkompromisses wurde – zumindest für einige Bereiche – einseitig aufgekündigt. Seit den 1990er Jahren wurde sie im wesentlichen auf Fragen des Arbeitsrechtes, der Arbeitsmarktpolitik und der Arbeitsbeziehungen beschränkt – die ehemals gesamtwirtschaftliche Orientierung der Sozialpartnerschaft und der Einfluss der Gewerkschaft darauf, neigten sich damit dem Ende zu. Verstärkter internationaler Wettbewerb, der Beitritt zur Europäischen Union, die Hinwendung zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik durch die große Koalition können als Gründe dafür identifiziert werden. Einen weiteren Einschnitt markierte der Regierungswechsel 2000 zur ÖVP-FPÖ- und später ÖVP-BZÖ-Koalition (Blaschke 2002, 91).
Aber auch die Veränderungen der Arbeitsverhältnisse, haben Einfluss auf die Macht der Gewerkschaften. Die Atypisierung der Arbeitsverhältnisse führt zu einer Aufspaltung der Interessenlagen von ArbeitnehmerInnen, die sich nicht mehr nach den klassischen Mustern organisieren lassen. Alternative Instrumente der Interessendurchsetzung – jenseits etwa der Einrichtung von Betriebsräten – konnten sich in der Gewerkschaft bislang aber kaum durchsetzten. Vielmehr stehen wir derzeit noch vor der Situation, dass das Problem an sich bisher kaum wirklich angegangen wurde. Hintergrund dafür dürfte nicht zuletzt der Umstand sein, dass die atypischen oder prekären Arbeitsverhältnisse überwiegend von Frauen eingenommen werden. Da die maskulinistische agierenden Gewerkschaften Frauenarbeit immer schon nur als Zuarbeit verstanden haben, zielt ihre Politik auch wenig auf die Problematik, die dieser Entwicklung innewohnt. Wenngleich in letzter Zeit – nicht zuletzt aufgrund der Krise des ÖGB – einige dieser Kritikpunkte in Angriff genommen wurden, ist davon auszugehen, dass eine angemessene Vertretung von Frauen noch einige Zeit dauern wird.
Problematisch daran ist nicht nur, dass damit soziale Gerechtigkeit von den Gewerkschaften selbst nur auf eine ausgewählte Gruppe – den männlichen, weißen Normalarbeiter – angewandt wird, – dies würde ja an sich schon genügen. Die Anerkennung und Unterstützung von gesellschaftlichen Spaltungen, die als herrschaftliche Konstrukte zu verstehen sind, wendet sich letztlich immer auch gegen die vorübergehenden Nutznießer einer solchen Politik. Denn eine rassistische und sexistische Spaltung dient letztlich immer auch dazu die Klassenspaltung zu stabilisieren, weil eine Konkurrenz mit NiedriglohnempfängerInnen hergestellt wird.
Um dem entgegenzuwirken dürfen sich Gewerkschaften nicht auf die vermeintlichen Kernfragen gewerkschaftlicher Politik reduzieren lassen. Gewerkschaften waren soziale Bewegungen, die angetreten sind die Lebenssituation der ArbeiterInnen zu verbessern und für eine gerechte Gesellschaft zu kämpfen. D.h. es geht nicht „nur „ um die Arbeitszeit, die Lohnerhöhung, Betriebsvereinbarungen usw. Es geht um viel mehr – nämlich um die Frage, wie wir leben wollen.
Das was heute ÖGB und AK allenfalls als „Schmuck“ ihrer Organisationen betrachten muss wieder in den Mittelpunkt rücken, den Bildungs- und Aufklärungsarbeit, werden heute wieder notwendiger denn je, wo die ArbeitnehmerInnenvertretung nicht mehr darauf zählen kann, wie eine „verfassungsmäßige Institution“ agieren zu können.
Die selbst geschaffene politisch weitgehend inaktive gewerkschaftliche Basis muss jetzt wieder aktiviert werden. Wurde die politische Selbstständigkeit – allerdings nicht nur in der Gewerkschaft – in den Jahrzehnten des Wirtschaftsaufschwunges durch Delegation politischer Verantwortung an Gremien und einer undemokratischen Organisationskultur stillgelegt, würde sie jetzt dringend gebraucht.
Der Machtverlust der Gewerkschaften macht heute mehr denn je ein agieren notwendig, das mehr jenem einer sozialen Bewegung ähnelt, als das einer quasi-staatlichen Institution. Und das ginge nicht zuletzt mit anderen Formen der Politik und anderen Politikinhalten einher. Die Demokratisierung aller Lebensbereiche, wie sie die sozialen Bewegungen seit den 1960er/70er Jahren proklamierten, sollten sich Gewerkschaften – in stärkerer Verbindung mit anderen politischen Akteuren wieder verstärkt zu eigen machen.
Abschließend möchte ich den spanischen Soziologen Adolfo Paramio mit einem Artikel von Anfang der 1980er Jahre zitieren – so alt der Satz ist, so richtig und so wenig umgesetzt ist er: „Die Hegemonie der Gewerkschaften [und ich denke man kann hier ergänzen: aller kritischen sozialen Bewegungen] wird davon abhängen, ob die Forderungen der Frauenbewegung integriert werden.“ – und zwar nicht im dem Sinn, wie das derzeit geschieht, in Form von abgesonderten und nicht in die Machtzentren integrierten Frauenabteilungen, sondern im Kern der Organisation und der Politik. Wird das nicht berücksichtigt, wird eine Politik des „Teile und Herrsche“ fortgesetzt. Kritische Analysen müssen zeigen, wie die Organisation des Privaten, der Familie, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung mit gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen verwoben sind und sie legitimieren. Denn die Trennung von Zusammenhängen war immer schon ein Instrument der Stabilisierung von Herrschafts- und Gewaltverhältnissen. In diesem Sinn geht es eben um eine Aneignung der „Hauptthese“ des Feminismus: „Das Private ist politisch!“
Literatur:
Appelt, Erna (1999). Geschlecht. Staatsbürgerschaft. Nation. Politische Konstruktionen des
Geschlechterverhältnisses in Europa. Frankfurt/New York: Campus-Verlag
Appelt, Erna/Alexandra Weiss (Hg.) (2001). Globalisierung und der Angriff auf die europäischen Wohlfahrtsstaaten, Hamburg: Argument Verlag.
Bakker, Isabella (1997). Geschlechterverhältnisse im Prozess der globalen Umstrukturierung. In: Braun/Jung (1997): 66-73.
Balibar, Etienne (1993). „Menschenrechte“ und „Bürgerrechte“. Zur modernen Dialektik von Freiheit und Gleichheit, in: Ders. (Hg.): die Grenzen der Demokratie, Hamburg.
Becker, Steffen/Thomas Sablowski/Wilhelm Schumm (Hg.) (1997). Jenseits der Nationalökonomie? Weltwirtschaft und Nationalstaat zwischen Globalisierung und Regionalisierung, Hamburg: Argument Verlag.
Becker-Schmidt, Regina/Gudrun-Axeli Knapp (Hg.) (1995). Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften, Frauenfurt a. M./New York: Campus-Verlag.
Blaschke, Sabine (2002). Der ÖGB: Gewerkschaftliche Reorganisation und Erneuerung, in: Kurswechsel H2/2002, 89-101.
Braun, Helga/Dörthe Jung (Hrsg.) (1997). Globale Gerechtigkeit? Feministische Debatte zur Krise des Sozialstaats. Hamburg: Konkret-Literatur-Verlag.
Buci-Glucksmann, Christine/Göran Therborn (1982). Der sozialdemokratische Staat. Die „Keynesinaisierung“ der Gesellschaft, Hamburg.
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (2005). Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2005, Wien.
Cyba, Eva (2000). Geschlecht und sozialen Ungleichheit. Konstellationen der Frauenbenachteiligung, Opladen: Leske + Budrich
Fink, Marcel (2000). Atypische Beschäftigung und deren politische Steuerung im internationalen Vergleich, in: ÖZP, 29. Jg., H 4, 401-415.
Frauenredaktion Argument (Hg.) (1984). Geschlechterverhältnisse, Berlin: Argument Verlag.
Ganßmann, Heiner (2001). Soziale Sicherheit und Kapitalmobilität. Hat der Sozialstaat ein Standortproblem? In: Appelt/Weiss (2001): 47-64.
Greif, Wolfgang/ Gerhard Gstöttner-Hofer/Erwin Kaiser/Sepp Wall-Strasser (Hg.) (1997): Denn sie wissen nicht, was wir tun! Gewerkschaften und Mitbestimmung, Wien: ÖGB-Verlag.
Hauch, Gabriella (1991). „Arbeite Frau! Die Gleichberechtigung kommt von selbst“? Anmerkungen zu Frauen und Gewerkschaften in Österreich vor 1914, in: Konrad (1991): 62-86.
Haug, Frigga (1996). Das neoliberale Projekt, der männliche Arbeitsbegriff und die fällige Erneuerung des Geschlechtervertrages, in: Das Argument 217, 38. Jg.; H 5/6, 683-696.
Haug, Frigga (1996). Frauen-Politiken, Berlin/Hamburg: Argument Verlag. Haug, Frigga (2003). Historisch-kritisches Wörterbuch des Feminismus, Hamburg: Argument Verlag.
Hirsch, Joachim (1998). Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, Berlin: ID-Verlag.
Ivekovic, Rada (1984). Noch einmal zu Marxismus und Feminismus, in: Frauenredaktion Argument (Hg.), Geschlechterverhältnisse, Berlin, 103-112.
Jenson, Jane (1997). Die Reinstitutionalisierung der Staatsbürgerschaft, in: Steffen Becker/Thomas Sablowski/Wilhelm Schumm (Hg.): Jenseits der Nationalökonomie? Weltwirtschaft und Nationalstaat zwischen Globalisierung und Regionalisierung, Berlin, 232-247.
Kreisky, Eva (1994). Das ewig Männerbündische? Zur Standardform von Staat und Politik“, in: Claus Leggewie (Hg. ): Wozu Politikwissenschaft? Über das Neue in der Politikwissenschaft, Darmstadt, 191-208.
Kreisky, Eva (1995). Der Staat ohne Geschlecht?. Ansätze feministischer Staatskritik und feministischer Staatserklärung, in: Eva Kreisky/Birgit Sauer (Hg.): Feministische Standpunkte in der Politikwissenschaft. Eine Einführung, Frauenfurt/New York, 203-222.
Leborgne, Danièle/Alain Lipietz (1996). Postfordistische Politikmuster im globalen Vergleich, in: Das Argument 217, Jg. 38, Heft 5/6, 1996, 697-712.
Lunzer, Gertraud (2006). Struktur und Verteilungswirkung des österreichischen Steuersystems, in: Kurswechsel 2006/1, 14-24.
Marx, Karl (1957 [1867]). Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erstes Buch, (hg. von Benedikt Kautsky), Stuttgart.
Münz, Rainer/Gerda Neyer (1986). Frauenarbeit und Mutterschutz in Österreich. Ein historischer Überblick, in: Rainer Münz/Gerda Neyer/Monika Pelz (Hg.), Arbeitsmarktpolitik. Frauenarbeit, Karenzurlaub und berufliche Wiedereingliederung, Wien, 13-76.
Neyer, Gerda (1997). Fraueninteressen und ÖGB, in: Wolfgang Greif et al (Hg.): Denn sie wissen nicht, was wir tun! Gewerkschaften und Mitbestimmung, Wien.
Pelz, Monika (1986). Frauenarbeit heute, in: Rainer Münz/Gerda Neyer/Monika Pelz (Hg.), Arbeitsmarktpolitik. Frauenarbeit, Karenzurlaub und berufliche Wiedereingliederung, Wien, 86-147.
Rosenberger, Sieglinde (2000). Frauenerwerbsarbeit – politische Kontextualisierung im Wandel der Arbeitsgesellschaft, in: ÖZP 2000/4, Jg. 29, 417-430.
Sauer, Birgit (2001). Feminisierung” eines männlichen Projekts? Sozialstaat im Zeitalter der Globalisierung, in: Erna Appelt/Alexandra Weiss (Hg.): Globalisierung und der Angriff auf die europäischen Wohlfahrtsstaaten, Hamburg, 67-83.
Sauer, Birgit (2003). „Gender makes the world go round”. Globale Restrukturierung und Geschlecht, in: Albrecht Scharenberg/Oliver Schmidtke (Hg.): Das Ende der Politik? Globalisierung und der Strukturwandel des Politischen, Münster, 98-126.
Scharpf, W. Fritz (1987). Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa, Frankfurt/New York.
Scott, Joan W.(1994). Die Arbeiterin, in: Geneviève Fraisse/Michelle Perrot (Hg.), Geschichte der Frauen. 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M./New York, 451-479.
Senf, Bernd (2001). Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der Krise, München.
Tálos, Emmerich/Gerda Falkner (1992). Politik und Lebensbedingungen von Frauen, in: Emmerich Tálos (Hg.), Der geforderte Wohlfahrtsstaat, Wien, 195-295.
Tálos, Emmerich/Karl Wörister (1994). Soziale Sicherung im Sozialstaat Österreich. Entwicklung – Herausforderung – Strukturen, Baden-Baden.
Watch Group. Gender und öffentliche Finanzen (2006). Elemente einer Gender-Analyse des Steuersystems, in: Kurswechsel 2006/1, 25-36.
Weiss, Alexandra (2004). Fraueninteressen und Gewerkschaftspolitik, in: Horst Schreiber/Rainer Hoffmann (Hg.): ÖGB-Tirol: Geschichte – Perspektiven - Biographien, Wien, 261-282.
Young, Brigitte (1998). Politik und Ökonomie im Kontext von Globalisierung. Eine Geschlechterkritik, in: Eva Kreisky/Birgit Sauer (Hg.): Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation, PVS Sonderheft 28/1997, 137-154.
Zitate:
1 Als Fordismus wird eine spezifische historische Formation des Kapitalismus bezeichnet, der sich in den USA seit den 1920er/30er und in Europa in der Nachkriegszeit durchsetzte und mit den 1970er Jahren zu Ende ging. „Namensgeber“ ist Henry Ford, der 1914 in seinen Autofabriken die Fließbandproduktion einführte. Diese Produktionsweise hatte nicht nur ökonomische, sondern auch soziale und politische Konsequenzen.
2 Darunter ist die industrielle Massenerzeugung von Gebrauchsgütern unter rationellster Nutzung der menschlichen Arbeitskraft zu verstehen.
3 Als Korporatismus wird die Zusammenarbeit von Staat und den Verbänden der ArbeitnehmerInnen und der ArbeitgeberInnen in Fragen der Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungspolitik bezeichnet. Die österreichische Variante des Korporatismus ist die Sozialpartnerschaft, die durch eine besonders hohe Autonomie der Verbände gegenüber dem Staat gekennzeichnet war.
4 Frauenspezifische sozialpolitische Forderungen bezogen sich in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts v.a. auf die Mutterschaft. So wurden Mitte der 1880er Jahre erste Mutterschutzgesetze beschlossen (allerdings mit schwacher Wirkung und für nur wenige Berufsgruppen). In den 1890ern wurden Frauenarbeitsschutzgesetze eingeführt, die letztlich dazu führten, dass Frauen aus den Betrieben in die Heimarbeit abgedrängt wurden, wo Schutzgesetze faktisch keine Wirkung hatten. Darüber hinaus gab es in der Arbeiterbewegung deutliche Bestrebungen, Frauen vom Arbeitsmarkt und aus der Bewegung selbst zu verdrängen. Argumentiert wurde hier zum einen mit der Konkurrenz durch die niedrigen Frauenlöhne, aber auch mit der „Unsittlichkeit“ von Frauen, die in Fabriken arbeiten oder sich in politischen Zusammenhängen engagieren. Die Frauen sollten sich – gemäß dem bürgerlichen Familienmodell – nur im privaten Bereich des Hauses bewegen (vgl. Scott 1994 und Hauch 1991).
5 Im 19. Jahrhundert verdienten Frauen in der Regel ca. 50 Prozent weniger als Männer (v gl. Hauch 1991)
6 Marx spricht im ersten Buch vom „Kapital“, 13. Kapitel „Maschinerie und große Industrie“ (III. „Nächste Wirkungen des maschinenmäßigen Betriebes auf den Arbeiter“) von einer Entwertung der männlichen Arbeitskraft durch die Maschinerie. Männer werden ersetzt durch Frauen und Kinder, also durch „unqualifizierte“ Arbeitskräfte, da die Muskelkraft durch die Maschinerie ersetzt wird (vgl. Marx 1957 [1867]: 251-259). Diese Argumentation findet auch heute noch Verwendung, vor allem wenn es um die Unterscheidung von qualifizierter und unqualifizierter Arbeit geht, die in der Regel geschlechtsspezifischen Trennlinien folgt.
7 Haug führt an, dass in Zuge der Automatisierung der Druckereien (Einführung des Fotosatzes) von den Gewerkschaften Sozialabkommen und Sperren vereinbart wurden, die das Einstellen von Frauen zunächst verboten (vgl. 1996: 169-170)
8 Die zweite Frauenbewegung als internationales Phänomen erlangte große öffentliche Aufmerksamkeit. So wurden frauen- bzw. geschlechterpolitische Anliegen verstärkt auch auf dem traditionellen politischen Parkett wahrgenommen und verhandelt. 1975 rief etwa die UNO das „Jahr der Frau“ aus und von 1976 bis 1985 die UNO-Dekade der Frau.
9 Zum einen stieß das Modell tayloristischer Arbeitsorganisation an Grenzen; Produktivitätswachstum konnte nun weniger mit Arbeitsteilung, sondern mehr mit technischer Innovation und Automatisierung erzielt werden. Zum anderen war die hierarchische und autoritäre Strukturierung der Arbeitsorganisation immer weniger mit den allgemeinen gesellschaftlichen Demokratisierungstendenzen zu vereinbaren.
10 Die steuerliche Belastung nach der Leistungsfähigkeit entspricht der Tradition der progressiven Einkommensbesteuerung. Höhere Einkommen werden demnach mit höheren Steuersätzen belastet.
11 Erbschaftssteuern, Grundsteuern, Vermögenssteuer, Grund- und Kapitalverkehrssteuer usw.
12 Die letzte generelle Arbeitszeitverkürzung fand 1975 statt: zwischen 1970 und 1975 wurde die Wochenarbeitszeit von 45 auf 40 Stunden reduziert.
13 Im Jahr 2003 war die Höhe der monatlichen mittleren Direktpensionen bei Arbeiterinnen 585,- Euro, bei Arbeitern 1.125,- Euro; bei den weiblichen Angestellten lagen sie bei 960,- Euro, bei den männlich en Angestellten bei 1.969,- Euro (vgl. Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 2005: 341).
Referat bei der GLB-Bundeskonferenz am 23. Juni 2007 in Wien.