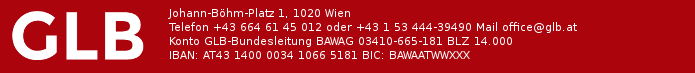Wer die große Zeche zahlt: Die Werktätigen als Mäzenaten
- Donnerstag, 14. Juni 2007 @ 08:22

 Von Lutz Holzinger
Von Lutz HolzingerEs existiert kaum ein Bereich des gesellschaftlichen Lebens, in dem neuerdings keine Sponsoren als Finanziers erforderlich sind. In der Aufregung über diese Entwicklung, die Konzerne und Private als Mäzene erscheinen lässt, wird vergessen, dass – abgesehen vom Spitzensport - der größte Finanzierungsanteil von sämtlichen Staatsausgaben immer noch von den Steuerzahlern kommt. Dabei handelt es sich um einen Club, der immer exklusiver zu werden droht, weil seine Mitglieder nahezu ausschließlich aus dem Kreis der Lohn-. und Gehaltsempfänger rekrutiert werden. Österreich ist anerkannter Maßen das Land mit dem niedrigsten Vermögenssteuersatz in der Europäischen Union. Die durchschnittliche Vermögenssteuer in der Gemeinschaft wiederum erreicht bei Weitem nicht das Niveau, das in den Vereinigten Staaten den Reichen und Superreichen zugemutet wird. Der Grund für die Ungleichbehandlung der Vermögenden in Österreich, der EU und den USA könnte darin bestehen, dass sie am Volkseinkommen ungleich partizipieren. Davon kann jedoch aus heimischer Sicht keine Rede sein. Bereits im Februar 2003 haben Markus Materbauer und Ewald Walterskirchen in „Arbeit & Wirtschaft“ einen Artikel mit dem Titel „Die Lohnquote sinkt seit zwei Jahrzehnten“ veröffentlicht.
Zu den Kernpunkten einer einschlägigen WIFO-Studie schreiben die beiden Autoren: „In Österreich ist die unbereinigte Lohnquote seit 1982 zurückgegangen: Von 76 auf 73 Prozent im Jahr 200. Diese Entwicklung hat jedoch nur eine sehr geringe Aussagekraft, weil sie mit einer starken Verringerung der Selbständigen – besonders in der Landwirtschaft – verbunden war. Verteilungspolitisch aussagekräftiger ist die Entwicklung der bereinigten Lohnquote. Diese weist seit 1982 eine wesentlich steilere Tendenz nach unten auf: Sie ging 1982 bis 2000 um 8 Prozentpunkte zurück, fast um eine halben Prozentpunkt pro Jahr. Noch stärker war die Verringerung der Netto-Lohnquote (nach Steuern). Darin spiegelt sich das Postulat der Angebotspolitik wider, dass die Unternehmen steuerlich besonders entlastet werden sollen, damit Investoren im internationalen Standortwettbewerb angelockt werden.“ Zurückgeführt wird diese Entwicklung darauf, dass es die hohe Arbeitslosigkeit in ganz Europa erlaubt habe, die Verteilungsfrage zurückzudrängen
Dass sich seither an dieser Umstand nichts geändert hat, meldete am 22. März dieses Jahres „derStandard.at“ unter der Überschrift: „Lohnquote sinkt, Gewinne steigen“. Wörtlich hieß es: „Die Schere zwischen Löhnen auf der einen Seite und Gewinnen der Unternehmen auf der anderen Seite hat sich in den vergangenen 30 Jahren deutlich verschärft. Betrug die Lohnquote - also der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Gesamteinkommen – 1975 80,0 Prozent, sank sie bis 2005 auf den Tiefstand von 65,8 Prozent. Die Gewinnquote erhöhte sich im selben Zeitraum von 20,0 auf 34,2 Prozent. ... Für 2006 gibt es lediglich Prognosen des WIFO. Demnach wird für das Vorjahr ein weiterer Rückgang der Lohnquote auf 65,7 und für 2007 auf 65,4 Prozent erwartet.“
Angesichts dieser Zahlen liegt auf der Hand, wo die Hauptursache der Krise des ÖGB tatsächlich liegt. Ihr Kern ist das Totalversagen in der Lohnpolitik, für das die Spitzengremien der Fachgewerkschaft verantwortlich sind. Ihnen ist es nicht gelungen, der neoliberalen Offensive der Unternehmer angemessen entgegen zu treten und dafür zu sorgen, dass die Produktivitätssteigerungen sich in den Lohnerhöhungen niederschlugen. Materbauer und Walterskirchen betonen: „Wir sollten ... keinem Politiker trauen, der uns verspricht, die Lohnstückkosten zu senken und gleichzeitig die Lohnquote zu erhöhen. der große Unterschied zwischen den beiden Konzepten liegt im Ziel: Früher wollte die Wirtschafts- und Sozialpolitik mit einer stabilen Lohnquote die Nachfrage festigen, heute versucht die vorherrschende Angebots. und Standortpolitik die Lohnstückkosten zu senken, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Der Konkurrenzkampf zwischen den Nationen steht im Vordergrund, nicht mehr die Entwicklung der Nachfrage im gesamten Wirtschaftsraum.“
Es ist bezeichnend für die ÖGB-Spitze, dass sie ihr Versagen in der Lohnpolitik schon geraume Zeit – quasi unabhängig von der Zusammensetzung der jeweiligen Regierung - durch die Forderung nach einer Steuerreform zu kompensieren trachtet. Der wunde Punkt dieser Strategie besteht darin, dass ohne gründliche Veränderung des gesamten Systems der Besteuerung für durchschnittliche Einkommensbezieher extrem wenig zu holen und daher kein Blumenstrauß zu gewinnen ist. Das hat nicht zuletzt die von der Regierung Schüssel II als Wahlzuckerl gedachte jüngste Steuerreform bewiesen. Sie ist an den Lohn- und Gehaltsbeziehern nahezu unbemerkt vorbeigegangen. Nicht weil Schüssel und Grasser schlechte Menschen sind, sondern weil die steuerliche Ergiebigkeit der Einkommen der unselbständig Erwerbstätigen unverzichtbar geworden ist.
Während die Stiftungen der Millionäre und Milliardäre mit dem enormen Druck von maximal 2,5 Prozent Steuerbelastung aushalten müssen, brauchen sich besser verdienende Lohnabhängige keine großen Gedanken machen, wie sie Erhöhungen ihre Bezüge verwenden, weil ihnen der Finanzminister 50 Prozent davon abnimmt. Bei kleinen Lohneinkommen besteht das Problem darin, dass zwar Lohnsteuer anfällt, aber mittlerweile die Abzüge für die Sozialversicherung die Netto-Zahlungen schwer belasten. Dass im Staate Österreich - als eines der reichsten Länder der Welt mit immer stärker steigender Armutsgefährdung – etwas faul ist, dämmert immerhin Sozialminister Erwin Buchinger. Er verlangt die Finanzierung der Altenpflege aus einem Zuschlag zur Vermögenssteuer. Dabei wurde es sich um einen Einstieg in die häufig als absolute Teufelei verdammte Wertschöpfungsabgabe handeln, die schon von Alfred Dallinger als unerlässlich für die Finanzierung des Sozialstaates gehalten wurde.
In der Praxis geht das Steueraufkommen in Österreich immer stärker zu Lasten der Werktätigen. Thomas Lachs, ehemaliger Direktor der Österreichischen Nationalbank und engagierter Gewerkschafter, hat für „Arbeit & Wirtschaft“ (Nr. 2/2005) wesentliche Daten präsentiert. Zunächst konstatiert er den vergleichsweise hohen Anteil der indirekten Steuern in Österreich, die bekanntlich sozial schwächere Zeitgenossen stärker belasten als betuchte Bürger. Lachs schreibt: „Bei uns machen indirekte Steuern über 30 Prozent der Steuereinnahmen aus. Zum Vergleich: In den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Frankreich sind es knapp unter oder knapp über 26 Prozent und in den sicher nicht extrem sozialen USA sind es sogar nur 17 Prozent.“
Anschließend stellt Lachs die Frage nach der Steuerverteilung und hält fest: „Bei den Steuern auf Vermögen zählt Österreich international gesehen zu den Schlusslichtern. Bei uns bezieht der Staat gerade einmal 2,7 Prozent seiner Einnahmen aus dieser Quelle, in Frankreich sind es 5 Prozent, in der Schweiz 7,1 Prozent und in Großbritannien stattliche 7,9 Prozent. Die Vereinigten Staaten beziehen sogar 11,4 Prozent ihrer Einnahmen von den Vermögen der Bürger.“ Noch aufschlussreicher ist die Gegenüberstellung der Lohnsteuern (also der Steuern auf Löhne, Gehälter und Pensionen) - und der Gewinnsteuern (also der veranlagten Einkommenssteuer, der Körperschaftssteuer und der Kapitalertragssteuer) in einem Vergleich der Jahre von 1975 bis 2005. Der ehemalige Direktor der Nationalbank kommt zu folgendem Ergebnis: „Der Anteil der Lohnsteuer an den gesamten Steuereinnahmen steigt in 30 Jahren kontinuierlich von 18 auf über 30 Prozent an, währen der Anteil der Gewinnsteuern zwar schwankt, aber insgesamt von 17,4 auf 14, 4 Prozent gesunken ist. Dabei sind diese Zahlen noch zugunsten der Gewinnsteuern ‚geschönt‘,. Denn ab 1995 sind in ihnen sowohl die neu eingeführte Kapitalertragssteuer auf Zinsen und die Körperschaftssteuer auf den Gewinn der Österreichischen Nationalbank enthalten.“
Lachs unterstreicht, dass diese Entwicklung angesichts der sinkenden Lohnquote besonders bedenklich ist. Dazu kommt, dass der Steuersatz für die Körperschaftssteuer, der 1975 noch pari mit der Lohnsteuer war, seither auf die Hälfte gesunken ist. Mit dem Ergebnis, dass namhafte Großunternehmen häufig nahezu keine Gewinnsteuern zahlen und mit Abstand wesentlich mehr Lohnsteuern abliefern. Auf der Hand liegt, dass die Hauptlast der Steuern auf die Werktätigen und die KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen) abgeladen wird.
Zwei Stoßrichtungen liegen auf der Hand, um die Steuerbelastung wenn schon nicht gerecht - denn aller gesellschaftlicher Reichtum wird von der lebendigen Arbeitskraft hervor gebracht -, so doch funktional zu verteilen:
1. Es gilt, die Schere zwischen Gewinnsteuern und Lohnsteuern durch die Erhöhung der Ersteren und die Senkung der Letzteren zu schließen.
2. Es ist die Einführung einer wirkungsvollen Wertschöpfungsabgabe erforderlich, um einerseits die Produktivitätsunterschiede zwischen Konzernen und KMUs ebenso wie zwischen einzelnen Branchen auszugleichen und andererseits den so genannten Faktor Arbeit zu entlasten, ohne die Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherung in Frage zu stellen.
Lutz Holzinger ist Journalist in Wien