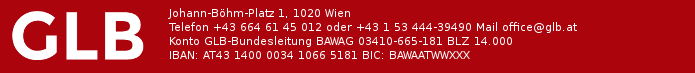Die neoliberale Offensive und die Politik der Gewerkschaften
- Samstag, 19. Mai 2007 @ 20:42
 Bei der zweiten Konferenz der Gewerkschaftslinken am 19. Mai 2007 in Wien referierte Bernd Riexinger von der Gewerkschaft Ver.di in Stuttgart zum Thema „Die neoliberale Offensive und die Politik der Gewerkschaften“. Nachstehend eine Mitschrift des Referats: Die neoliberale Politik ist eigentlich gescheitert, die damit verbundenen Versprechungen haben sich als Lügen erwiesen. Trotzdem ist der Neoliberalismus ökonomisch weiter auf dem Vormarsch: durch die Angriffe auf die Sozialsysteme wie Pensionen, Gesundheit oder Arbeitslosenversicherung, die Durchsetzung eines breiten Niedriglohnbereichs, durch die Verbürokratisierung der Politik und den Trend zu einer autoritären Politik und vor allem durch eine Umverteilung in einem gigantischen Ausmaß.
Bei der zweiten Konferenz der Gewerkschaftslinken am 19. Mai 2007 in Wien referierte Bernd Riexinger von der Gewerkschaft Ver.di in Stuttgart zum Thema „Die neoliberale Offensive und die Politik der Gewerkschaften“. Nachstehend eine Mitschrift des Referats: Die neoliberale Politik ist eigentlich gescheitert, die damit verbundenen Versprechungen haben sich als Lügen erwiesen. Trotzdem ist der Neoliberalismus ökonomisch weiter auf dem Vormarsch: durch die Angriffe auf die Sozialsysteme wie Pensionen, Gesundheit oder Arbeitslosenversicherung, die Durchsetzung eines breiten Niedriglohnbereichs, durch die Verbürokratisierung der Politik und den Trend zu einer autoritären Politik und vor allem durch eine Umverteilung in einem gigantischen Ausmaß.Die Sozialpartnerschaft wurde durch die Kapitalseite aufgekündigt, die Gewerkschaften sind seit Jahren in der Defensive, entsprechende Schlussfolgerungen daraus fehlen allerdings. Viele GewerkschafterInnen, vor allem auch in den Betrieben, agieren wie früher der verarmte Adel: Sie erwecken den Anschein, als wäre alles intakt, als hätte sich nichts geändert. Das erschwert und verhindert eine Klärung für die künftige Orientierung.
Der Streik im öffentlichen Dienst
In Deutschland wurde 2006 im öffentlichen Dienst 14 Wochen gegen die Verlängerung der Arbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden gestreikt. Dem vorausgegangen waren Bestrebungen zur „Modernisierung“ des Tarifsystems durch Abkoppelung vom öffentlichen Dienst für rund fünf Millionen Beschäftigte. Das Ergebnis von Verhandlungen im Zeitraum von 2003 bis 2006 war eine Absenkung der Löhne, verbunden mit einer angeblichen Arbeitsplatzgarantie.
Dieses Ergebnis hat aber nicht lange gehalten, bald brachen die Länder aus und wollten 41 oder 42 Wochenstunden für Neuanstellungen. Insbesondere die Länder unter Führung der CDU/CSU, allen voran Bayern, wollten sich damit als Vorbild für die Privatwirtschaft profilieren. In Hamburg, Niedersachsen und Baden-Württemberg wurden die Tarifverträge aufgekündigt. Während es in Hamburg eine Einigung auf die Verlängerung der Wochenarbeitszeit um 0,3 Stunden gab, war der Konflikt in Baden-Württemberg am härtesten.
War zunächst die Einschätzung vorhanden, dass die Arbeitszeit nicht streikfähig war, so wurde bald das Gegenteil erwiesen. Der Hintergrund dafür war die ständige Verdichtung der Arbeitszeit verbunden mit einem laufenden Arbeitsplatzabbau und der Diffamierung des öffentlichen Dienstes als Nutznießer der SteuerzahlerInnen. Als Schwäche zeigte sich die schon vorher stattgefundene Abkoppelung der Bereiche Verkehr und Energie aus der Tarifgemeinschaft. Hingegen zeigte sich eine enorme Mobilisierung bei Müllabfuhr, Kindergartenpersonal und Spitälern, wobei gerade MigrantInnen die Hauptakteure im Streik, allerdings nicht in den Gewerkschaften waren.
Praktiziert wurde ein flexibler Streik indem wechselweise verschiedene Einrichtungen bestreikt wurden. Als in der Müllabfuhr private Firmen als Streikbrecher eingesetzt wurden, wurde dies durch eine Blockade der Müllverbrennungsanlage unterlaufen. Es gab täglich große Streikversammlungen mit einigen tausend TeilnehmerInnen, wobei sich eine demokratische Streikkultur entwickelte. Dazu kamen wöchentliche Demonstrationen verbunden mit der Darstellung des Kampfes gegen die Arbeitszeitverlängerung als öffentliche Angelegenheit.
Im Ergebnis wurde die Einigung auf 39 Stunden als Erfolg gesehen, weil diese nicht als fauler Kompromiss, sondern als Ergebnis der Kräfteverhältnisse zustande kam. Gezeigt hatte sich, dass die Streikfähigkeit in den Städten ausgeprägt vorhanden war, in den ländlichen Gebieten jedoch nur bedingt, weil sich dort Bürgermeister und Landräte als Hardliner gezeigt hatten. Dem Streik war große Sympathie der Bevölkerung, jedoch zuwenig aktive Solidarität entgegengebracht worden.
Arbeitskampf bei Allianz
Der Versicherungskonzern Allianz ist ein durchorganisiertes Unternehmen mit bislang traditionellen Arbeitsverhältnissen, wo es üblich war, nach abgeschlossener Ausbildung bis zur Pension beschäftigt zu sein. Ausgelöst wurde der Konflikt durch die Pläne für eine Reorganisierung als „Deutschland AG“ mit dem Abbau von 7.000 Arbeitsplätzen und der Schließung hunderter Standorte.
Dahinter steht ein typischer Shareholder-Kapitalismus, wies Allianz doch keinerlei Profitprobleme auf. Der Gewinn betrug zum Zeitpunkt des Arbeitskampfes bereits vier Milliarden Euro, für heuer sind sechs Milliarden, für die nächsten Jahre 13 Milliarden geplant.
Zentrum des Konflikts war Stuttgart, wo 15 Demonstrationen und zahlreiche Betriebsversammlungen stattfanden. Die drei Hauptforderungen waren die Ablehnung von Standortschließungen, die Ablehnung betriebsbedingter Kündigungen und beides verbunden mit Chancen für die Beschäftigung und damit Zukunft die Jugend. Der Konflikt erstreckte sich über ein Jahr und wurde mit einem in Form einer Betriebsvereinbarung erzielten Kompromiss beendet. Dabei wurde zwar ein Arbeitsplatzabbau akzeptiert, aber Standortschließungen konnten verhindert werden.
Gezeigt hatte sich dabei eine Differenz zwischen Betriebsräten, die über Betriebsvereinbarungen verhandelten und der Gewerkschaft, die über den Tarifvertrag verhandelte, wodurch die Position der Betriebsräte gestärkt wurde. Als wichtig wurde die große öffentliche Sympathie gesehen, indem tausende Kunden aktiviert und 200.000 Unterschriften gesammelt sowie viele Verträge gekündigt wurden. Ähnlich wie beim Streik im öffentlichen Dienst kam eine aktive Solidarität aber auch hier nicht zustande.
IG Metall und Ver.di gegen Rente mit 67
Die Agenda 2010 der rotgrünen Regierung unter Kanzler Schröder mit dem Kernpunkt Hartz IV war der größte Eingriff in das Sozialsystem in Deutschland. Die Gewerkschaften entwickelten nur sehr zögerlich Widerstand dagegen. Auf Initiative der sich formierenden Gewerkschaftslinken kam es im Herbst 2003 zu einer Großdemonstration mit 100.000 TeilnehmerInnen in Berlin, die dann auch für den DGB Anlass war, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Allerdings wurde der Kampf nicht konsequent weitergeführt, sondern kanalisiert.
Eine Fortsetzung findet die Agenda 2010 mit der Rente mit 67 unter der jetzt amtierenden schwarzroten Regierung. Im Herbst 2006 demonstrierten rund 400.000 Menschen gegen dieses Vorhaben in vielen Städten. Da in Deutschland politische Streiks verboten sind, wurde durch eine andere Definition derselben eine Orientierung auf Arbeitsniederlegungen diskutiert, die aber nur bedingt gelungen sind.
Es kam nur zu einer Welle solcher Arbeitsniederlegungen, dann flaute die Bewegung ab, vor allem weil es in Deutschland anders als etwa in Frankreich keine Tradition politischer Streiks gibt und es bislang nie gelungen ist mehr als eine Million Menschen für politische Anliegen auf die Straße zu bekommen und sich etwa eine halbe Million als Obergrenze erwiesen hat.
Auch werden die Gewerkschaften zuwenig ernst genommen und wird ihnen nicht zugetraut auch politische Ziele zu erreichen. Für die Mitglieder war zudem unklar, ob der Protest ernst gemeint oder nur als Dampfablassen gedacht war. Als wirksam erwiesen sich Plakataktionen mit Politikerfotos und dem Text „Auch ich habe für die Rente mit 67 gestimmt“. In der Folge kam es zur Ausladung von SPD-PolitikerInnen als MairednerInnen durch DGB-Organisationen.
Telekom-Streik gegen Lohnkürzung
Die deutsche Telekom hat seit ihrer Ausgliederung bereits 18 Umstrukturierungen hinter sich. Die gewerkschaftliche Orientierung wandte sich dabei nicht gegen die Zerschlagung, sondern auf die Mitgestaltung des Umbaus. Jetzt erfolgt der Angriff auf die Kernbeschäftigten, indem 55.000 Beschäftigte ausgegliedert werden sollen.
Dabei sollen die Löhne um zehn bis 30 Prozent gesenkt und gleichzeitig die Arbeitszeit von 34 auf 40 Stunden verlängert werden. Wurde früher eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnverzicht durchgesetzt, so soll jetzt die Verlängerung mit einem weiteren Lohnverzicht erfolgen. Der Vorstand droht bei Weigerung mit dem Verkauf der betroffenen Bereiche. Die Telekom ist ein profitabler Betrieb, doch der Teilhaber Blackstone betreibt eine typische Shareholder-Politik.
Nach sechs Tagen Warnstreik wird jetzt zum Dauerstreik übergegangen, als Schwäche zeigt sich dabei, dass nur der Servicebereich bestreikt wird. Die Hälfte der Belegschaft hat immer noch einen Beamtenstatus, wobei jedoch juristisch zu prüfen wäre, wie dieser in einer ausgegliederten AG in Hinblick auf das Streikverbot für Beamte zu interpretieren ist.
Laut Umfragen haben 80 Prozent der Bevölkerung Sympathie für den Streik, was einen einmalig hohen Wert darstellt. Der Bund ist immer noch der größte Aktionär und besitzt die Mehrheit der Telekom. Daher stellt der Vorstoß des Vorstandes den bislang größten Angriff auf die Rechte der Beschäftigten dar, wenn der Vorstand damit durchkommt, wäre dies ein Dammbruch für andere Bereiche. Es gibt hohe Erwartungen an die Gewerkschaft, ein Abschluss mit vielen Zugeständnissen würde als negativ empfunden. Der Streik wird zentral geführt, daher gibt es vor Ort nur gegrenzte Möglichkeiten des Handelns.
Gewerkschaften im Shareholder-Kapitalismus
Die Kampffelder der Gewerkschaften haben sich im Shareholder-Kapitalismus verlagert, die Gewerkschaften sind bislang aber nicht darauf eingestellt. Folgende Aspekte sind dabei wesentlich:
• Es gibt eine wachsende Dominanz des Finanzkapitals mit entsprechendem Druck auf die Realwirtschaft. Das Ziel, die Renditen maximal zu erhöhen, bedeutet im Ergebnis Personalabbau, Lohndruck und Sozialabbau.
• Durch die Überakkumulation sucht das Kapital ständig neue Anlagebereiche, die vor allem in der überwiegend noch im öffentlichen Eigentum stehenden Daseinsvorsorge gesehen werden.
• Der Shareholder-Kapitalismus nährt sich aus der Umverteilung, etwa durch den Abbau der öffentlichen Daseinsvorsorge und aus Steuererleichterungen für die Konzerne.
• Regulierungen werden für den Wettbewerb als störend empfunden, daher erfolgt ein massiver Angriff auf Tarifvereinbarungen, werden diese durchlöchert steigt die Erpressbarkeit der Belegschaften.
• In der EU und WTO gibt es eine Dominanz dieses neoliberalen Politikansatzes.
Ein Zurückdrängen des Neoliberalismus erfordern die Hinterfragung dessen Grundlagen, dazu ist derzeit jedoch keine Strategie der Gewerkschaften vorhanden. Aber auch ständige Neuregelungen auf immer niedrigerem Niveau stehen irgendwo an. Notwendig ist ein Aktionsprogramm der Gewerkschaften sowohl national als auch international mit folgenden Punkten:
• Zurückdrängen des Niedriglohnsektors, der Leiharbeit und der prekären Arbeitsverhältnisse, etwa durch eine Kampagne für einen gesetzlichen Mindestlohn.
• Steigerung der Reallöhne, diese sind in Deutschland in den letzten zehn Jahren im Gegensatz zu anderen EU-Ländern gesunken.
• Verkürzung der Arbeitszeit und Stoppen der Flexibilisierung. Es ist ein Fehler, dass die Gewerkschaften auf das Thema Arbeitszeitverkürzung verzichten.
• Eine europäische Kampagne gegen die Privatisierung der öffentlichen Dienste, wie Post, Bahn, Verkehr usw. Ein Einlassen den öffentlichen Bereich wettbewerbsfähig zu machen verhindert keine Privatisierungen.
• Bündelung der Kräfte gegen die Konzernstrategien, welche die Steigerung der Börsenkurse und Dividenden als Priorität betrachten.
• Konkretisierung der Internationalisierung der Gewerkschaftspolitik zur Überwindung der Standortrivalität. Geeignete Themen dafür sind die Arbeitszeitverkürzung, der Kampf gegen Privatisierung oder die internationale Vernetzung im Kampf gegen Sozialabbau.
• Bündnisse mit den Kunden der jeweiligen Unternehmen bzw. mit den KonsumentInnen von Dienstleistungen.
Zur Entwicklung der Linken
Die Sozialdemokratie ist führend bei der Modernisierung des Kapitalismus. In Deutschland ist die SPD dabei geradezu von Selbstmordgedanken besessen und hat deswegen in den letzten Jahren 300.000 Mitglieder verloren. Als Reaktion auf die Agenda 2010 entstand 2004, vorwiegend getragen vom Mittelbau der Gewerkschaften, die WASG mit der Absicht eine eigene Partei zu bilden, nachdem die PDS im Westen kaum präsent war. Bei der Landtagswahl 2005 in Nordrhein-Westfahlen scheiterten WASG mit 2,2 Prozent und PDS mit 0,9 Prozent durch getrennte Kandidaturen.
Bei der von Kanzler Schröder vorzeitig veranlassten Bundestagswahl 2005 ergab sich verbunden mit der Bereitschaft von Lafontaine ein Zwang für eine gemeinsame Kandidatur als einmalige historische Chance. Mit 8,7 Prozent wurde das historisch beste linke Ergebnis seit 1949 erzielt, mit dem Einzug der Linken in die Bremer Bürgerschaft verbunden mit dem Anspruch als Vertretung für die sozial ausgegrenzten und einer klaren Oppositionsansage erweist sich die Linke jetzt auch im Westen als stabile Kraft.
Die Linke hat ein klar antineoliberales, aber kein sozialistisches Programm, sie ist eine Sammelbewegung der Linken. Die Sympathien in den Gewerkschaften, insbesondere bei den aktiven Mitgliedern und im Mittelbau für die Linke ist groß, dort gibt es teilweise schon mehr Einfluss als seitens der SPD, wie sich mit der Ausladung von SPD-RednerInnen am 1. Mai gezeigt hat.
Die Gewerkschaften brauchen eine linke Vertretung, die Linke transportiert deren Themen. Ein Beispiel ist die Kampagne für einen gesetzlichen Mindestlohn, den jetzt auch die SPD zum Thema gemacht hat. Bezeichnend ist aber, dass ein Antrag der Linken mit dem Text einer früheren SPD-Resolution von der Mehrheit der SPD-Abgeordneten abgelehnt wurde.
Die Linke hat Chancen, wenn sie antineoliberal und oppositionell agiert, aber nicht wenn sie neoliberale Politik exekutiert wie etwa in Berlin. Das Schlechteste wäre, wenn die Linke mitregieren müsste, derzeit besteht diese Gefahr aber nicht. Wichtig ist auch die Trennung von Amt und Mandat, Promis sind für die mediale Vermittlung wichtig, aber die Linke darf nicht auf sie reduziert werden, allerdings wäre ohne Lafontaine und Gysi der Erfolg wie bei der Bundestagswahl nicht möglich gewesen.
Mitschrift von Leo Furtlehner (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)