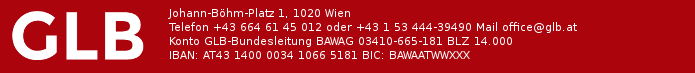Wie weiter mit dem ÖGB?
- Samstag, 24. Februar 2007 @ 20:03
 Die Ergebnisse des 16. Bundeskongresses des ÖGB sind ernüchternd und enttäuschend zugleich. Die Chance für eine grundlegende Reform des sich in einer tiefen politischen sowie finanziellen Krise befindenden ÖGB wurde nicht genützt, die Hoffnungen hunderttausender Mitglieder enttäuscht. Der ÖGB agiert weiterhin als Gewerkschaft der FunktionärInnen statt eine der Mitglieder zu werden. Statt Bewegung von unten ist weiterhin Parteipolitik von oben angesagt. Statt einer Loslösung von der Sozialpartnerschaft und der Unterordnung unter die Interessen von Kapital und Regierung wird diese fortgesetzt. Die Einzelgewerkschaften sind in ihren Machtkämpfen gegeneinander dermaßen gefangen, dass sie durch ihre Schrebergartenpolitik das Gesamte schon längst aus den Augen verloren haben – sie sind vielmehr schon dabei, sich von einem einheitlichen Dach eines starken ÖGB zu verabschieden. Weiterhin ordnen SpitzengewerkschafterInnen im Nationalrat, Bundesrat oder Landtagen die Interessen von Gewerkschaftsmitgliedern und Beschlüssen des ÖGB der Parteiräson unter. Eine Bezügeobergrenze von 5.800 Euro netto entspricht 11.000 Euro brutto und zementiert damit die Abgehobenheit von SpitzengewerkschafterInnen.
Die Ergebnisse des 16. Bundeskongresses des ÖGB sind ernüchternd und enttäuschend zugleich. Die Chance für eine grundlegende Reform des sich in einer tiefen politischen sowie finanziellen Krise befindenden ÖGB wurde nicht genützt, die Hoffnungen hunderttausender Mitglieder enttäuscht. Der ÖGB agiert weiterhin als Gewerkschaft der FunktionärInnen statt eine der Mitglieder zu werden. Statt Bewegung von unten ist weiterhin Parteipolitik von oben angesagt. Statt einer Loslösung von der Sozialpartnerschaft und der Unterordnung unter die Interessen von Kapital und Regierung wird diese fortgesetzt. Die Einzelgewerkschaften sind in ihren Machtkämpfen gegeneinander dermaßen gefangen, dass sie durch ihre Schrebergartenpolitik das Gesamte schon längst aus den Augen verloren haben – sie sind vielmehr schon dabei, sich von einem einheitlichen Dach eines starken ÖGB zu verabschieden. Weiterhin ordnen SpitzengewerkschafterInnen im Nationalrat, Bundesrat oder Landtagen die Interessen von Gewerkschaftsmitgliedern und Beschlüssen des ÖGB der Parteiräson unter. Eine Bezügeobergrenze von 5.800 Euro netto entspricht 11.000 Euro brutto und zementiert damit die Abgehobenheit von SpitzengewerkschafterInnen.Der folgenschwerste Beschluss des Kongresses ist allerdings die Teilrechtsfähigkeit für die Einzelgewerkschaften, die von der GÖD-Spitze umgehend zum Anlass für eine Verselbständigung genommen wurde und welcher die anderen Gewerkschaftsblöcke folgen werden. Durch das Hausmachtdenken und die Schrebergartenmentalität der Gewerkschaftsspitzen wurde die Chance, einen einheitlichen starken ÖGB mit KV-fähigen Untergliederungen zu schaffen, bewusst verworfen.
Die Vorteile einer solchen Lösung wären evident: Das Prinzip „Ein Betrieb, eine Gewerkschaft“, eine flache aber einheitliche ÖGB-Struktur, mehr Zusammenhalt und Solidarität statt „Reibungsverlusten“ durch rivalisierende Teilgewerkschaften, enorme Synergieeffekte und leichtere Finanzierung durch einen gemeinsamen Overhead (Bildung, Internationales, Verwaltung etc.).
Der GLB befindet sich wie andere kritische Minderheitsfraktionen auch in einer widersprüchlichen Situation: Einerseits bekennen wir uns als MitbegründerInnen des ÖGB zum einheitlichen überparteilichen Gewerkschaftsbund. Die Bildung von Separatgewerkschaften wäre in der jetzigen Situation zum Scheitern verurteilt, wie Beispiele der letzten Jahre bewiesen haben. Andererseits kritisiert der GLB die Politik der großen Fraktionen massiv und grundsätzlich und versucht Alternativen dazu zu entwickeln.
Gefordert ist in den nächsten Jahren ein verstärktes intensives Nachdenken über zukunftsweisende Konzepte für die Entwicklung der Gewerkschaften und deren Politik. Dabei gilt es vor allem einma,l einer weit reichenden Veränderung der ArbeiterInnenklasse vom traditionellen „Normalarbeitsverhältnis“ hin zu einer immer weiter greifenden Prekarisierung Rechnung zu tragen.
Das Selbstverständnis des ÖGB als Interessenvertretung muss somit wesentlich verbreitert werden und verstärkt Gruppen wie Erwerbsarbeitslose, MigrantInnen, Prekarisierte, Scheinselbständige usw. einschließen, die nicht dem traditionellem Verständnis entsprechen. Notwendig ist auch ein wesentlich stärkeres Zusammenwirken mit neuen sozialen Bewegungen um breite Alternativen gegen den neoliberalen Kapitalismus zu entwickeln.
Die beschlossene Frauenquote kann nur ein Ausgangspunkt sein, wobei es nicht nur um die Besetzung von Spitzenfunktionen mit Frauen geht. Vielmehr müssen die von Prekarisierung (Teilzeitarbeit, atypische Beschäftigung, Mehrfachbelastung usw.) betroffenen Frauen wesentlich stärker als bisher überhaupt zum Maßstab der Gewerkschaftspolitik werden.
Nach wie vor ist der Lohnkampf das „Kerngeschäft“ der Gewerkschaften, eine realistische Bilanz über die Entwicklung der letzten Jahre zeigt freilich, dass künftig ein wesentlich konsequenterer Kampf für die elementaren Interessen der Lohnabhängigen verbunden mit einer klaren Absage an die Standportpolitik der Unternehmen notwendig sein wird.
Was für den ÖGB als Gesamtes gilt, ist auch für den GLB selbst wichtig. Nach seinem 2005 beschlossenen Selbstverständnis versteht sich der GLB „als kritisches Korrektiv, als Ferment und soziales Gewissen“ in Betrieben, Gewerkschaften und Arbeiterkammern und mit „profiliert linken Positionen“ auch als „Bezugspunkt für kritische GewerkschafterInnen anderer Fraktionen“.
Die inhaltliche Seite dazu als wesentliche Forderungen haben wir ebenfalls im Selbstverständnis des GLB definiert: Die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums durch eine entsprechende Steuerpolitik. Eine aktive Lohnpolitik zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe. Die Erhaltung und der Ausbau des Sozialstaates und des öffentlichen Eigentums. Die Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn. Gleiche Bildungschancen für alle. Die Gleichstellung von Frauen. Gleiche Rechte für MigrantInnen. Ein allgemeines öffentliches Gesundheitswesen sowie eine gesicherte Pensionsvorsorge für alle.
GLB-Bundesleitung 24. Februar 2007