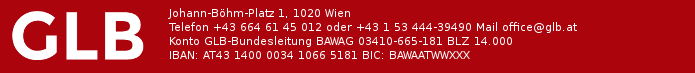Privatisierung: Warnungen wurden ignoriert
- Mittwoch, 11. Oktober 2006 @ 06:00

 Von Hubert Schmiedbauer
Von Hubert SchmiedbauerWer die Folgen der Privatisierung, der Ausgliederung und Zerstückelung, der Herstellung angeblicher „Wettbewerbsfähigkeit“, der Rationalisierung zugunsten des Aktienkapitals zu tragen hat, erfahren die Betroffenen täglich. Widerstand gab es seit Jahrzehnten. Kürzlich hörte man wieder von der SPÖ, es solle keine weiteren Privatisierungen geben. Ach ja, die Post-KollegInnen wählen demnächst und bei der Post – neben Telekom, AUA und OMV – besitzt die ÖIAG noch Anteile. Mit dem Anschluss an die EU, der in Gewerkschaften und Arbeiterkammern massiv propagiert wurde, fielen die letzten Schranken für die Entfesselung einer hemmungslosen Profitwirtschaft. Niemand darf sich ausreden: „Des hamma net g´wusst…“ Warnungen gab es genug. Hier ein paar Beispiele.
Für die Wirtschaft in öffentlicher Hand – bezogen auf die Dienstleistungen - gebe es einen Versorgungsauftrag in der Fläche, meinte 1994 der heutige BAWAG-Chef Ewald Nowotny*) und er wies am Beispiel der privatisierten Deutschen Bundespost nach, wie dieser Auftrag verloren geht. Öffentliche Unternehmen seien Instrumente der Wirtschaftspolitik – das betrifft auch die verstaatlichte Industrieproduktion - und bei der Privatisierung entstünden verteilungspolitische Folgen: Die Bereitstellung von Leistungen sei nicht neutral, so werde in der EU diskutiert, denn es würden z.B. in der E-Wirtschaft durch die Marktmacht der Großkonzerne spezielle Lieferverträge und Leitungsrechte ermöglicht, von denen nur die Großkonzerne zu Lasten der Privathaushalte und der Klein- und Mittelunternehmen profitieren.
Auch der damalige Chef der Verbundgesellschaft, Walter Fremuth*), widerspricht im selben Diskussionsprozess dem Schlagwort vom notwendigen Rückzug der öffentlichen Wirtschaft zugunsten der Privatwirtschaft. Der Staat habe Zielvorgaben zu fixieren – allerdings sollten Politiker nicht in das Management „hineinfunken“. Zielsetzungen, die über das Betriebswirtschaftliche hinausgehen, seien legitim, müssten aber gesagt und begründet werden. Er sprach sich für Joint-Ventures zwischen öffentlichen und privaten Eigentümern aus, entscheidend sei jedoch, wer das Sagen hat, wo der Einfluss liegt und wer diesen Einfluss in welcher Form ausübe.
Und was tat sich in ÖGB und AK?
Wer erinnert sich noch an die Kämpfe der KollegInnen in der Stahlindustrie und speziell im Voest-Alpine-Konzern u.a. mit den TV-Sendungen zur Mobilisierung des Widerstands gegen die Diffamierung der Verstaatlichten, in der E-Wirtschaft mit den eindrucksvollen Versammlungen in Wien, bei Semperit mit Beteiligung vieler Organisationen, an die unzähligen kleineren Aktionen im ganzen Land? Haben die leitenden Organe des ÖGB und der AK alle Möglichkeiten ausgeschöpft?
Warnungen und Argumente kamen seit Jahren. Reprivatisierung sei Bestandteil der politischen Strategie der neokonservativen Strömungen, die in der Mehrzahl der EG-Staaten die Regierungspolitik bestimmen, stellte eine Studie der AK 1987**) fest. In dieser Dokumentation wird auch das ÖVP-Konzept „zur Privatisierung und Eigentumsbildung“ angeführt. Es geht zurück auf die Vorschläge der OECD zur „Stimulierung des Wettbewerbs“, in dem die Sektoren Transport, Post- und Telekommunikation, Rundfunk und TV, Energie, Bankwesen usw. angeführt sind.
Einleitend weist die Studie nach, dass die Privatisierung „natürlicher Monopole“ allein keine Effizienzsteigerung bringe, sondern die Zersplitterung eher nachteilige Folgen habe und vor allem für kleinere Länder aus ökonomischen Gründen nicht in Frage komme. Zur Anschaulichkeit seien noch zwei Beiträge zitiert, die von damaligen AK-Expertinnen und nunmehrigen Managerinnen großer Konzerne stammen:
Argumenten für eine Reprivatisierung zur betriebswirtschaftlichen Entwicklung sei entgegenzuhalten, dass sie nicht unbedingt eine Privatisierung voraussetzen, stellt Wilhelmine Goldmann, nunmehrige ÖBB-Vorstandsdirektorin, fest. Eine Privatisierung bringe die große Gefahr mit sich, dass ausländisches Kapital noch mehr Einfluss auf österreichische Betriebe gewinne. Der Stellenwert der Verstaatlichten in der Gesamtindustrie Österreichs sei seit 1950 nahezu unverändert geblieben.
Ein verheerendes Zeugnis stellen B. Ederer (nunmehrige Chefin von Siemens Österreich) und E. Beer der Entwicklung der Bankenkonzerne (Betriebe im Besitz von Länderbank und CA) aus: 1984 arbeiteten dort zwar noch fast 10% der österreichischen Industriebeschäftigten (55.000), doch es herrsche ein Mangel an strategischen Überlegungen. Die Verkäufe von Teilunternehmen gingen überwiegend an ausländische Unternehmen und wurden zum Teil zur „verlängerten Werkbank“.
Das war 1987. Einige Jahre später war Ederer als Staatssekretärin eine der Propagandistinnen und Vollzieherinnen des EU-Anschlusses.
Problem erkannt, zur Lösung nicht fähig
Gehen wir noch weiter zurück. Der ÖGB-Rednerdienst – die monatliche Anleitung für Gewerkschaftsfunktionäre, Betriebsräte, Vertrauensleute – behandelt in Nr.1/1983 „Entstehung, Funktion und Probleme der Verstaatlichten“. Es wird Klage geführt über die Diffamierungskampagne der ÖVP, mit der die Zerschlagung und Privatisierung der öffentlichen Wirtschaft vorangetrieben werde. Es bestand damals eine SPÖ-Alleinregierung.
Und was machte der ÖGB in dieser Situation? Statt den Kampf um die Erhaltung und den Ausbau des öffentlichen Sektors anzuleiten – in der Stahlkrise wanderten in den westlichen Staaten etwa 700 Milliarden Schilling (!) an Subventionen zur Eisen- und Stahlindustrie! -, wird von den Beschäftigten und Betroffenen „Verständnis“ dafür eingefordert, dass Opfer zu bringen seien. In Produktion, Beschäftigung, bei den sozialen Zuwendungen usw. gebe es außergewöhnliche Maßnahmen und die Aufgabe der Gewerkschaften sei es, „diese Opfer auf ein erträgliches Ausmaß zu reduzieren“.
Zehntausende Arbeitsplätze wurden mittlerweile vernichtet und Sozialabbau in großem Umfang betrieben. (Siehe den nebenstehenden Kasten von Karl Russheim.) Dafür gab es unzählige Anträge, Resolutionen und programmatische Beschlüsse der Gewerkschaften und Arbeiterkammern zur notwendigen „Erhaltung strategischer Mehrheiten“, zur „Sicherung des Familiensilbers“ und ähnliche Stehsätze, die zwar dem Willen der Basis entsprachen, aber folgenlos blieben.
Die ÖIAG als Dachgesellschaft der Verstaatlichten reformierte in der Folge ihren Konzern – um ihn privatisierungsreif zu machen. Großbanken wurden Stück für Stück dem Auslandskapital zugeschanzt. Was die SPÖ-Alleinregierung und danach die SPÖ-ÖVP-Koalition eingeleitet haben, die Sparpakete und Pensions“reformen“ der neunziger Jahre, den EU-Anschluss, das Fehlen jedes Widerstands gegen die Verschärfung der „neoliberalen“ Profitwirtschaft führten schließlich zur Vollendung des eingeschlagenen Weges durch die ÖVP-FPÖ-Koalition. Da war es mit dem erträglichen Ausmaß endgültig vorbei.
Doch in den letzten Jahren, als die ÖGB-Führung durch die Unzufriedenheit der ArbeiterInnen und Angestellten gezwungen war, die Muskeln spielen zu lassen, ging es stets nur bis zur Schwelle des Erfolges. Dann wurde mit dem Vorwand „Demokratie“ auf das Parlament verwiesen und die demokratisch nicht legitimierte „Sozialpartnerschaft“ beschworen, um die sich Industrie- und Bankkapital ohnehin nicht mehr scheren. Die Macher des Neoliberalismus treiben weiter ungehindert Regierungen und EU-Administration vor sich her und lachen sich über GewerkschafterInnen bucklig, die mit Mitteln der bürgerlichen Demokratie oder gar durch Mitjonglieren im kapitalistischen Spekulationszirkus vorgeben, die Interessen ihrer Mitglieder und aller Lohnabhängigen nachhaltig wahren zu können. Aber das hat die Geschichte längst widerlegt.
*) Zeitschrift für Gemeinwirtschaft 3/1994
**) AK Wien, September 1987: Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr.35: Öffentliche Unternehmen und die Frage der Privatisierung.