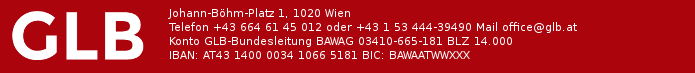Herbstlohnrunde wird zur Nagelprobe für den ÖGB
- Montag, 25. September 2006 @ 11:05
 Für den im Gefolge des BAWAG-Skandals in eine existenzielle Krise geratenen ÖGB wird die Herbstlohnrunde 2006 zu einer Nagelprobe für seine künftige Entwicklung, meint die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB). „Ein positives Signal um wieder Vertrauen bei den frustrierten Mitgliedern zu gewinnen kann nur ein Lohnabschluß sein, der sowohl die Inflation abgilt als auch dem Produktivitätswachstum Rechnung trägt und einen kräftigen realen Einkommenszuwachs für die ArbeiterInnen und Angestellten bringt“, meint GLB-Bundesvorsitzende Karin Antlanger und verbindet dies auch mit der Forderung nach einem Mindestlohn von 1.300 Euro bzw. acht Euro pro Stunde.
Für den im Gefolge des BAWAG-Skandals in eine existenzielle Krise geratenen ÖGB wird die Herbstlohnrunde 2006 zu einer Nagelprobe für seine künftige Entwicklung, meint die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB). „Ein positives Signal um wieder Vertrauen bei den frustrierten Mitgliedern zu gewinnen kann nur ein Lohnabschluß sein, der sowohl die Inflation abgilt als auch dem Produktivitätswachstum Rechnung trägt und einen kräftigen realen Einkommenszuwachs für die ArbeiterInnen und Angestellten bringt“, meint GLB-Bundesvorsitzende Karin Antlanger und verbindet dies auch mit der Forderung nach einem Mindestlohn von 1.300 Euro bzw. acht Euro pro Stunde. Die Unternehmerseite will die Schwäche der Gewerkschaften dazu benützen, um nur mehr die Inflationsrate abzugelten, darüber hinaus erfolgende Erhöhungen jedoch in die Betriebe zu verlagern und damit das Verhandlungsmandat auf die Betriebsräte zu verlagern. Die logische Fortsetzung wäre, dass künftig Lohnverhandlungen überhaupt nur mehr auf betrieblicher Ebene erfolgen, womit Gewerkschaften überflüssig würden.
Der ÖGB hat sich beim Thema Arbeitszeit mit einem falschen Verständnis von „Reform“ ohnehin bereits seit Jahren auf das Unternehmer-Credo der Flexibilisierung – im Klartext Ausdehnung ohne Überstundenzuschläge – eingelassen. Das Ergebnis ist, dass der ÖGB zwar seit 1987 regelmäßig die 35-Stundenwoche verlangt, praktisch aber Österreich heute mit 44,3 Stunden die längste reale Wochenarbeitszeit der EU aufweist.
Auch mit den gerade in der Metallbranche jahrelang praktizierten Optionsklauseln zugunsten betrieblicher Erhöhungen bzw. Mitarbeiterbeteiligungen haben die Gewerkschaften bereits ihre Position bei den Lohnverhandlungen geschwächt. Es ist kein Zufall, dass Kanzler Schüssel in der TV-Konfrontation neuerlich die Mitarbeiterbeteiligung – durch welche nur Lohngelder in spekulatives Kapital eingebracht werden sollen – aufgewärmt hat. Im Gegensatz dazu lehnt der GLB Mitarbeiterbeteiligungen ab und tritt für klare Verhältnisse zwischen Lohnarbeit und Kapital ein.
Angesichts der günstigen Wachstumsprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute von rund drei Prozent gibt es keinen Grund für die Gewerkschaften, sich bei den Lohnverhandlungen zurückzuhalten. Laut Arbeiterkammer ist die Produktivität pro Kopf von 1996 bis 2006 um 15,1 Prozent, der Bruttolohn jedoch nur um 5,9 Prozent und der Nettolohn um 4,2 Prozent gestiegen. Nach Deutschland und Belgien weist Österreich mit einem Reallohnzuwachs zwischen 2002 und 2006 um 0,9 Prozent im Jahresdurchschnitt gegenüber einem Produktivitätswachstum um 1,6 Prozent den größten Lohnrückstand im EU-Vergleich auf.
Um die Position der Gewerkschaften zu stärken, hält der GLB eine breite Mobilisierung der ArbeiterInnen und Angestellten durch Betriebsversammlungen vor, während und nach den Verhandlungen für notwendig. Nach deutschem Beispiel muss dies auch mit einer Urabstimmung über das Ergebnis verbunden sein, das wäre ein deutliches Zeichen eines Neubeginns auch im ÖGB.