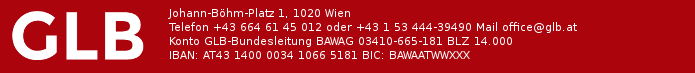GLB weist Crash-Programm der Industrie zurück
- Mittwoch, 6. September 2006 @ 11:29
 Als Kampfansage an die Lohnabhängigen bezeichnet die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) die Wünsche von Industriellenpräsident Veit Sorger an eine künftige Bundesregierung Auf dem Speisezettel des für seine BZÖ-Nähe bekannten Frantschacher-Chefs Sorger stehen unter anderem: Senkung des Spitzensteuersatzes von 50 auf 40 Prozent bei gleichzeitiger Erhöhung des damit zu besteuernden Einkommens von 51.000 auf 100.000 Euro, Abschaffung der Erbschaftssteuer, Zehnstunden-Normalarbeitstag ohne Überstundenzuschläge mit 60-Stundenwoche bei zwei Jahren Durchrechnungszeitraum, „Alternative“ Beschäftigungsmodelle im Sinne von Ein-Euro-Jobs, Greencard für Arbeitskräfte aus den Ostländern unter ausdrücklichem Bezug auf einen Vorschlag der Grünen sowie die Freigabe der Ladenöffnungszeiten und Sonntagsöffnung.
Als Kampfansage an die Lohnabhängigen bezeichnet die Fraktion Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB (GLB) die Wünsche von Industriellenpräsident Veit Sorger an eine künftige Bundesregierung Auf dem Speisezettel des für seine BZÖ-Nähe bekannten Frantschacher-Chefs Sorger stehen unter anderem: Senkung des Spitzensteuersatzes von 50 auf 40 Prozent bei gleichzeitiger Erhöhung des damit zu besteuernden Einkommens von 51.000 auf 100.000 Euro, Abschaffung der Erbschaftssteuer, Zehnstunden-Normalarbeitstag ohne Überstundenzuschläge mit 60-Stundenwoche bei zwei Jahren Durchrechnungszeitraum, „Alternative“ Beschäftigungsmodelle im Sinne von Ein-Euro-Jobs, Greencard für Arbeitskräfte aus den Ostländern unter ausdrücklichem Bezug auf einen Vorschlag der Grünen sowie die Freigabe der Ladenöffnungszeiten und Sonntagsöffnung.Der hochdotierte Manager Sorger – er rangierte bereits 2003 mit 766.000 Euro Jahreseinkommen auf Platz 16 der bestbezahlten ManagerInnen – brüskiert mit diesen Vorschlägen nicht nur die Lohnabhängigen, sondern auch die Gewerkschaften, die wider besseren Wissens immer noch auf die überkommene Sozialpartnerschaft setzen: „Für Manager vom Schlage Sorgers ist diese Sozialpartnerschaft längst zu einem Fetzen Papier verkommen, ein weiterer Anlass für den ÖGB eine härtere Gangart gegen die immer frecheren Unternehmerwünsche einzuschlagen“, meint dazu GB-Bundesvorsitzende Karin Antlanger.
Der GLB hält dem Crash-Programm der Industriellenvereinigung die reale Lage gegenüber: Trotz Wirtschaftswachstum und überdurchschnittlich steigenden Gewinnen stagnieren die Lohneinkommen. Die leichte Konjunkturbelebung stützt sich nur auf Exporte und reicht durch das Zurückbleiben des privaten Konsums nicht aus um die hohe Arbeitslosigkeit zu reduzieren.
Laut Arbeiterkammer Oberösterreich ist der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen von 1993 bis 2006 von 73,8 auf 66,3 Prozent gesunken. Gleichzeitig haben sich allein 2005 die Gewinne der ATX-Unternehmen gegenüber 2004 um 53 Prozent, die Dividenden um 58 Prozent, der Personalaufwand aber nur um ein Prozent erhöht. Während sich Erwerbstätige heute um nur vier Prozent mehr leisten können als vor zehn Jahren ist im selben Zeitraum der geschaffene Wohlstand mehr als dreimal so stark gewachsen.
Im Jahre 2004 entfielen auf die obersten 20 Prozent der ArbeitnehmerInnen 46,2 Prozent, auf die mittleren 60 Prozent 51,5 Prozent, auf die untersten 20 Prozent aber nur 2,3 Prozent der Einkommen. Während die Zahl der Dollar-Millionäre in Österreich auf mittlerweile 67.700 gestiegen ist, gelten 1,03 Millionen Menschen als armutsgefährdet. Bereits 250.000 Menschen gelten trotz Erwerbstätigkeit als arm und für immer mehr Lohnabhängige reicht das Geld nicht mehr für das tägliche Leben.
Immer mehr wird daher die Erhöhung der Kaufkraft nicht nur für Menschen mit geringem Einkommen sondern auch für die Wirtschaft zur Schlüsselfrage. Im Gegensatz zu den Plänen der Industrie tritt der GLB daher für eine aktive Lohnpolitik mit Abgeltung von Inflation und Produktivitätswachstum, einen Mindestlohn von 1.300 Euro bzw. acht Euro pro Stunde, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn, eine höhere Besteuerung von Kapital und Vermögen und Bemessung der Unternehmerbeiträge zur Sozialversicherung nach der gesamten Wertschöpfung ein: „Nur so kann einer weiteren Verschlechterung für Lohnabhängige, Prekarisierte und Erwerbslose und damit auch der wachsenden sozialen Verunsicherung gegengesteuert werden“, so Antlanger abschließend.