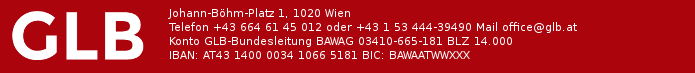60 Jahre Verstaatlichte: Ein bürgerliches Trauerspiel
- Sonntag, 9. April 2006 @ 13:12

 Von Lutz Holzinger
Von Lutz HolzingerVor 60 Jahren wurde im Nationalrat das erste Verstaatlichungsgesetz verabschiedet. Es betraf die Grundstoff- und Elektroindustrie. Ein Jahr später war auch die Elektrizitätswirtschaft an der Reihe. Das Pfund, das damit den beiden führenden Parteien des Landes in die Hand gegeben wurde, wurde nach dem durch diesen Wirtschaftszweig alimentierten Wiederaufbau der Privatwirtschaft verschleudert. Die KPÖ hat wiederholt die Rolle eines Gralshüters der Verstaatlichten Industrie gespielt. Ursprünglich war die Parteiführung – hin und her gerissen zwischen nationalen Eigeninteressen und Reparationsforderungen der Sowjetunion – über den Beschluss des ersten Verstaatlichungsgesetzes im Juli 1946 alles andere als glücklich. Die eigentliche Ursache für die Verstaatlichung sprach Bundeskanzler Julius Raab offen aus: „Keine private Stelle wäre damals in der Lage gewesen, jene ungeheuren Kapitalien aufzubringen, die notwendig waren, um die Schlüssel-Industrie wieder in Gang zu bringen.“
Zur parteipolitischen „Tuchentverteilung“ schreibt Ernst Hainisch in Anschluss an das Raab-Zitat im Band 1890 – 1990 der „Österreichischen Geschichte“: „Der Streit der Parteien betraf so lediglich den Umfang der Verstaatlichung, die SPÖ wollte eher mehr, die ÖVP eher weniger; beider Parteien aber standen unter dem Druck der Sowjets bezüglich des deutschen Eigentums. Das erste Verstaatlichtengesetz am 26. Juni 1946 wurde einstimmig beschlossen; auch die zögerliche KPÖ musste mitstimmen. Wahrlich paradox, dass ausgerechnet die Sowjetunion gegen die Verstaatlichung protestierte; ihr lag das Hemd des eigenen ökonomischen Interesses eben näher als das Kleid der Ideologie.“ (S. 411 f.)
Unabhängig von den unterschiedlichen politischen Einschätzungen der Verstaatlichten ist unbestritten, dass diese ökonomische Basis einen, wenn nicht den wesentlichen Unterschied zwischen Erster und Zweiter Republik darstellt. War die Grundstoffindustrie in der Zwischenkriegszeit fest in deutscher Hand und wesentlich weniger weit entwickelt, so befand sie sich – durch die Kriegswirtschaft des Nationalsozialismus – stark erweitert sowie ergänzt um die Energiewirtschaft sowie klassische Industriebetriebe in ehemals deutschem Eigentum wie Siemens in Staatsbesitz.
Strikter Proporz
Damit wurden diese Betriebe, für die bis zum Ende der großen Koalition 1966 eine eigene Sektion im von der SPÖ geführten Verkehrsministerium zuständig war, rasch zu einem Spielball des in der alten, großen Koalition zwischen ÖVP und SPÖ (von 1948 bis 1966) üblichen Proporzes. Im Zeichen dieser Zwei-Farben-Lehre wurden sämtliche Führungsposten mit einem schwarzen und einem roten Parteigänger besetzt. Mangels Expertise derartiger Persönlichkeiten musste mitunter zusätzlich ein echter Fachmann engagiert werden.
War schon diese Auswahl der Führungskräfte der Entwicklung der Unternehmen nicht besonders zuträglich, so wurde sie durch die Unterordnung unter die Interessen der beiden Großparteien zusätzlich beeinträchtigt. Der ÖVP ging es als Anwalt der unmittelbar nach dem Krieg diskreditierten und kapitalschwachen Privatunternehmern vor allem darum, die Aktivitäten der Verstaatlichten auf die Bereitstellung von Grund- und Rohstoffen zu beschränken und deren Weiterverarbeitung privaten Unternehmungen zu überlassen.
Unter der damaligen Abschottung der Binnenwirtschaft war es nicht weiter schwierig, durch künstlich niedrig gehaltene Rohstoffpreise für die Alimentierung bzw. Quersubventionierung der Privatbetriebe zu sorgen. Gleichzeitig konnte das in den verstaatlichten Betrieben konzentrierte Know-how auf dem Gebiet der Metallurgie und verwandten Bereichen nicht dafür genutzt werden, um wirkungsvoll in die Herstellung von Investitions- und/oder Konsumgütern vorzustoßen. Die in der damaligen Zeit allen Beteiligten einleuchtende Forderung der KPÖ, die Finalproduktion in der Verstaatlichten zu forcieren und damit die Weltmarktfähigkeit der Unternehmen zu untermauern und früh die Zukunft zu sichern, wurde von der unausgesprochene Vereinbarung zwischen den Großparteien torpediert, dies – koste es, was es wolle – zu verhindern.
Freie Hand in Personalfragen
Schon allein um den Einfluss der KPÖ in den Betrieben zu minimieren, der sich etwa im Zuge des Oktoberstreiks 1950 als beachtlich erwiesen hatte, bekam die SPÖ freie Hand, in allen nicht die unmittelbare Führung der Betriebe betreffenden Personalangelegenheiten ihr eigenes Süppchen zu kochen. Diese Orientierung führte dazu, dass die Arbeiterbetriebsrats-Vorsitzenden in der verstaatlichten Großkonzernen zu den einflussreichsten Stützen der Macht im Lande wurden. Ihr „Verdienst“ war es, bereits in den Einstellungsgesprächen die gewerkschaftliche Organisation und damit die Zugehörigkeit zur SP-Fraktion der Beschäftigten sicher zu stellen.
Dementsprechend massiv entwickelte sich der Einfluss dieser so genannten Betriebskaiser vom Zuschnitt der Ruhaltinger und Rechberger in den jeweiligen Fachgewerkschaften und im ÖGB sowie in den Arbeiterkammern und den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung. Sie agierten als AK-Präsidenten und Nationalratsabgeordnete, leisteten sich auf Unkosten der Unternehmen Akademiker als Sekretäre und ließen sich in Dienst-Mercedes chauffieren, die zum Teil „dicker“ waren als die „ihrer“ Generaldirektoren.
Gerechtfertigt wurde dieser quasi feudale Stil mit der Tatsache, dass die Verstaatlichten als Vorreiter bei der Durchsetzung sozialer Errungenschaften auf gesamtnationaler Ebene fungiert haben und mit ihrer Monopolstellung für die Sicherung der Vollbeschäftigung in ganzen Regionen wie Linz samt dem Mühlviertel, der Obersteiermark sowie Teilen von Wien, des Innviertels, der Weststeiermark, Kärntens usw. Lange Zeit waren die Verstaatlichten tatsächlich der Fels in der Brandung der heimischen Wirtschaft. Mit rund 20 Prozent der Beschäftigten und rund einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts war dieser Sektor seinerzeit weit mehr als doppelt so groß wie heute die gesamte Automobilwirtschaft samt ihrer hoch gelobten Zulieferindustrie.
Für die Zukunftssicherung der Unternehmen, die als unsinkbare Tanker betrachtet wurden, engagierten sich beinahe nur die in der Gewerkschaftlichen Einheit (GE) und später im Gewerkschaftlichen Linksblock (GLB) organisierten Betriebsräte und Arbeiter. Ihnen wurden so viel Prügel wie möglich vor die Beine geworfen. Legendär waren die Anstrengungen der SPÖ im Böhlerwerk in Kapfenberg, durch die Bildung von Kleinstwahlkreisen Mandatsgewinne des GLB zu verhindern. Im Vergleich dazu erscheint die Gangart Lukaschenkos bei den jüngsten Wahlen in Weißrussland als Gehabe von Waisenknaben.
Hohes Ansehen unter Kollegen
Dennoch gelang es engagierten Kollegen aus dem Kreis des GLB Betriebspositionen aufzubauen und langfristig zu halten. Derartige Kerne waren bei der VÖEST in Linz, der Voest-Alpine in Donawitz, der Voest-Alpine in Zeltweg, der AMAG in Braunau, der Voest-Alpine in Traisen, der VEW in Waidhofen an der Ybbs und vielen mehr. Die Kämpfer an der jeweiligen Fraktionsspitze genossen hohes Ansehen unter ihren Kollegen und in den Fachgewerkschaften, so dass sie auch bei der Besetzung von Gewerkschaftsleitungen nicht übergangen werden konnten. Meist in der krassen Minderheit, konnten sie ihre Ziele und Forderungen meist nur bedingt durchsetzen, wenngleich sie den Anstoß für zahlreiche Verbesserungen für die Beschäftigten gegeben haben.
Bewegung in die Organisation der Verstaatlichten kam mit der Annäherung bzw. Assoziation Österreichs an die EWG und die damit verbundene Aufhebung von Zollbarrieren, die bis dahin einige Zweige der heimischen Wirtschaft vor dem internationalen Wettbewerb geschützt hatten. Bereits die ÖVP Alleinregierung unter Kanzler Josef Klaus (1966 – 1970) lagerte die Verantwortung für die verstaatlichten Betriebe in eine Industrie-Holding aus. Sie wurde unter der SPÖ-Alleinregierung (1970 – 1983) beibehalten und ist mittlerweile zur heutigen Ausverkaufsholding ÖIAG mutiert. Bruno Kreisky versprach bei Amtsantritt den Verstaatlichten eine ÖIAG-Milliarde. Im Zuge ihrer Verselbständigung und der Zusammenlegung der Betriebe in Brancheholdings wie Stahl, Edelstahl, Aluminium usw. sollte sie zur Verbesserung der Ausstattung mit Eigenkapital beitragen. Gezahlt wurden jedoch nur geringfügige Teilbeträge
In der Praxis wurden Unternehmen zwar zusammen gezwungen, die sich bis dahin – wie das etwa im Edelstahlbereich der Fall war – bis aufs Messer bekämpft hatten und ihren Standortpatriotismus beibehielten. Das war einer sinnvollen Aufgabenteilung ebenso wenig zuträglich wie das Ausbleiben der zusätzlichen Geldmittel, die erforderlich gewesen wären, um rasch neue Produktionsvorhaben in Angriff zu nehmen. Vielmehr Schlug die Stunde groß angelegter Studien von ausländischen Betriebsberatungsgesellschaften, die Unsummen verschlungen, aber die Unternehmen dennoch auf keinen grünen Zweig gebracht haben.
Eine der damaligen Moden im Management war die Orientierung auf Diversifizierung und neue Technologien. Es wurde versucht, auf diesen Zug ebenso aufzuspringen, wie die immer schon lukrativen Geschäfte mit den Ländern der Zweiten und Drittel Welt weiter zu intensivieren. Unter anderem um die Finanzierung der Geschäfte mit den sozialistischen Ländern zu erleichtern und deren Warenlieferungen in Cash umzuwandeln, wurde die Intertrading forciert. Eine Indiskretion über ihre Bartergeschäfte mit Öl leitete den Untergang des stolzen Sektors ein. Das war quasi die Vorbereitung auf die Rückkehr der ÖVP in die Regierungsgeschäfte, die nach dem Intermezzo der rot-blauen Koalition (1983 – 1986) unter Kanzler Fred Sinowatz – unter dem 1986 noch Großdemonstrationen in Linz und Leoben für den Erhalt der Konzerne über die Bühne gingen – und Franz Vranitzky von letzterem vollzogen wurde.
Von da an ging es – offenkundig wie zwischen SPÖ und ÖVP schon allein in Hinblick auf den EU-Beitritt vereinbart – mit der Verstaatlichten ebenso rasch bergab wie mit den Privatisierungsgewinnlern bergauf. Im Eilzugstempo wurde das „Familiensilber“ verscherbelt, ohne dass der Staatshaushalt entlastet worden wäre. Der soeben neu gebildete Aufsichtsrat der ÖIAG unter Peter Mitterbauer, ausgerechnet ein ehemaliger Präsidenten der Industriellenvereinigung, soll den heutzutage beinahe als revolutionär erscheinenden „Schutt“ offenkundig endgültig wegräumen; Infrastrukturunternehmen wie Telekom Austria und Post gleich eingeschlossen.
Wir haben es mit einer bürgerlichen Staatsmacht zu tun, die vermehrt den Eindruck erweckt, sich selbst überflüssig zu machen. Ganz abgesehen von der Verstaatlichten wird auch in allen Beamtenbereichen privatisiert auf Teufel komm heraus. Seltsamer Weise trifft das auf die für Recht und Ordnung verantwortlichen Exekutivbereiche und das Militär nur bedingt zu. Damit scheinen seltsamen Zeiten einer durch Privatisierung notfalls mit staatlicher Gewalt durchgesetzte Aufhebung der Vergesellschaftung von Produktion und Reproduktion auf uns zuzukommen.