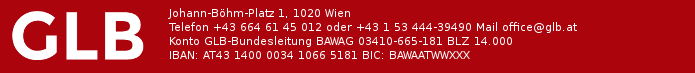Soziale Dimension als große Chance
- Dienstag, 24. Januar 2006 @ 22:30

 Von Lutz Holzinger
Von Lutz HolzingerJournalist in Wien
Österreich hat den Minderwertigkeitskomplex, den der Zerfall der Donaumonarchie ausgelöst hat, noch immer nicht ganz überwunden. Anders wäre es nicht denkbar, dass die heimische Öffentlichkeit die routinemäßige Übernahme der EU-Präsidentschaft zum Großereignis aufgebauscht hat. Der Vorsitz im Europäischen Rat wechselt jedes halbe Jahr. Bei derzeit 25 Mitgliedern, kommt jeder EU-Staat alle 12,5 Jahre zu dieser vermeintlichen Ehre. Sie ist mit viel Arbeit und großem Aufwand für die hochgestellten Besucher verbunden. Nach wie vor ist es Tradition, dass neben der Tätigkeit in Brüssel die diversen Ratssitzungen im jeweiligen Vorsitzland über die Bühne gehen.
Statt dafür die Strukturen der EU-Zentrale zu benützen, wird mit Tagungen an malerischen Orten Fremdenverkehrswerbung betrieben. Der Gebrauchswert hält sich in engen Grenzen, auch wenn die Industriellenvereinigung mit einem zusätzlichen Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent rechnet. Die Ratssitzungen im jeweiligen Vorsitz-Land werden nicht ohne Grund als Faustpfand einer immer wieder auf die lange Bank geschobenen gründlichen EU-Reform gehandelt.
Man muss kein Experte sein, um zum Urteil zu gelangen, dass die EU sich seit dem Nein der FranzösInnen und HolländerInnen zum Verfassungsentwurf in einer hartnäckigen Krise befindet. Dieses Grundgesetz wurde ursprünglich als Voraussetzung dafür betrachtet, um die Union auch nach dem massiven Erweiterungsschritt um zehn auf 25 Mitglieder funktionsfähig zu erhalten.
Neoliberale Orientierung
Gescheitert ist das Verfassungsprojekt jedoch nicht an dem Profil, das den Institutionen gegeben werden sollte. Die Referenden gingen vielmehr daneben, weil das Wahlvolk den Braten gerochen hatte: Unter dem Vorwand, die Arbeitsfähigkeit der Gemeinschaft zu gewährleisten, wurde im Entwurf die Orientierung auf ein neoliberales Wirtschaftsregime fest geschrieben, ohne gleichzeitig die soziale Dimension zu garantieren.
An diesem Stolperstein für die Europäische Verfassung kommt nun auch die österreichische Präsidentschaft nicht vorbei. Da die Wenderegierung explizit eine neoliberale Politik auf ihr Banner geschrieben hat, ist es kein Wunder, dass Kanzler Wolfgang Schüssel und Außenministerin Ursula Plassnik, sich zu den Erfolgsaussichten ihrer Vorsitzführung bisher äußerst kleinlaut geäußert haben.
Denn nachdem kurz vor Torschluss eine mühsame Einigung über den EU-Haushalt ab 2007 erzielt werden konnte, der übrigens den lächerlichen Betrag von kaum einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Gemeinschaftsländer ausmacht, ist die Reparatur der Verfassung nun überfällig. Dass in diese Frage Bewegung kommen muss, deutet eine – offenbare mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel abgesprochene - Ankündigung des französischen Staatspräsidenten Jaques Chirac an, wonach der Verfassungsentwurf im Sozialbereich nachgebessert werden müsse.
Mit der heimischen Regierungsspitze wurde in dieser Hinsicht freilich der Bock zum Gärtner gemacht. Es müsste schon ein Wunder geschehen, wenn ausgerechnet Schüssel ein Kompromiß für die Überwindung der krisenhaften Entwicklung gelänge, die vor allem auf dem Bedürfnis der Bevölkerung nach sozialer Sicherheit und der damit unvereinbaren Orientierung der federführenden politische Kräfte am Neoliberalismus beruht.
Vorrang für Profitrate
Im Grunde geht es um das Dilemma, dass für das international operierende Kapital die Befindlichkeit von Nationalstaaten oder auch von Zusammenschlüssen von Staaten wie der EU bei der Durchsetzung seiner Interessen keine Rolle mehr spielt. Die Optimierung der Profite im Weltmaßstab hat derartig an Gewicht gewonnen, dass auf historisch gewachsene Sonderentwicklungen wie den Sozialstandards in Westeuropa keine Rücksicht mehr genommen wird.
Der soziale Status quo kann daher nur dann aufrechterhalten werden, wenn den Wirtschaftsinteressen kein Freibrief ausgestellt wird, sondern unter der unerlässlichen Mitwirkung der politischen Ebene entsprechende Barrieren errichtet werden. Dazu ist in unserer Hemisphäre das Gros der Politiker im Gegensatz zur Mehrheit der Betroffenen allerdings noch nicht bereit.
Dass hierzulande die Uhren anders gehen, zeigt ein Vorstoß der Industriellenvereinigung zur gesetzlichen Flexibilisierung der Arbeitszeit. Mit der Formel „10-12-60-2“ soll eine Erhöhung der täglichen Normalarbeitszeit von acht auf zehn Stunden, der Höchstarbeitszeit von täglich 10 auf 12 Stunden und wöchentlich auf 60 Stunden sowie ein zweijähriger Durchrechnungszeitraum erreicht werden, obwohl die ÖsterreicherInnen mit 44,1 Stunden (inklusive Überstunden) schon jetzt die zweitlängste reale Wochenarbeitszeit in der EU leisten. Kein Wunder, dass die Begeisterung der österreichischen Bevölkerung für die EU an einem Tiefpunkt angelangt ist. Das Sozialdumping im Lande wird vor allem dem EU-Beitritt zugeschrieben.
Sozialer Mehrwert erforderlich
Elmar Altvater schrieb zur sozialen Dimension der Gemeinschaft: „Die Legitimation der EU steht und fällt mit der Frage: Welche Bedeutung hat Europa für ‚Trivialitäten‘ wie Beschäftigung und Löhne oder für die Gesundheitsvorsorge, für eine Versorgung mit Bildung und Ausbildung, für gesicherte Alterspensionen, für die Regulierung von Steuern und Schulden? Europa wächst mit dem sozialen Mehrwert, den die Integration für die Bürger erbringt, mit den materiellen Vorteilen und Hoffnungen, die sich auf realistische Zukunftsperspektiven beziehen- oder es wächst eben nicht.“ (Freitag, 51/52 2005)
Damit trifft der fortschrittliche Politikwissenschaftler und Politökonom ins Schwarze. Er verweist ferner auf folgenden Zusammenhang: „Die Bolkestein-Richtlinie über den Dienstleistungshandel ist ein Beispiel für den Abbau nationalstaatlichen Schutzes ohne die Bereitschaft, auf europäischer Ebene neue Schutzvorschriften für die Arbeitenden zu erlassen. Negative Integration pur.“
Die Gefahr, die hinter derartigen Entwicklungen lauert, beginnen auch sozialdemokratische und christlich-soziale Gewerkschafter zu erkennen. Das zeigte sich auf der Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer Ende November 2005 in Salzburg. Präsident Herbert Tumpel erklärte, dass die Dienstleistungsrichtlinie die größte Bedrohung für das österreichischen Arbeits- und Sozialsystem, für das Lohnniveau und den Arbeitsmarkt darstellen. Die heftige Diskussion über den Gesetzentwurf, die bisher unter anderem mehr als tausend Abänderungsanträge im EU-Parlament nach sich gezogen habe, sei kein Anlass für eine Entwarnung. Tumpel wörtlich: „Die Giftzähne sind der Dienstleistungsrichtlinie nicht gezogen.“
Fiasko zu befürchten
In diesen Tenor stimmten auch die „schwarzen“ Landesarbeitskammer-Präsidenten Josef Fink (Vorarlberg) und Fritz Dinkhauser (Tirol) ein. Die Senkung der Lohnkosten allein führt nach Fink lediglich zu einem Kaufkraftverlust. Den Klein- und Mittelbetrieben werde nach Dinkhauser die Existenzgrundlage entzogen. Als Gastrednerin wies Gerda Falkner vom Institut für Höhere Studien (IHS) auf eine Studie hin, wonach von sechs arbeitsrechtlichen Richtlinien in den EU-15-Ländern nur elf Prozent pünktlich und richtig in nationales Recht umgesetzt worden seien.
Altvater warnte vor folgendem Szenario: „Nur auf Märkte zu setzen und das soziale Netz verschleißen zu lassen – das wird vielen Unternehmen nutzen, dem europäischen Projekt aber den Garaus machen.“ Und er sieht die Gefahr, dass für die Konsequenzen nicht die vor allem im Rat – jeweils von der eigenen Regierung mit beschlossenen – besiegelten Spielregeln, sondern Konkurrenten aus anderen EU-Staaten verantwortlich gemacht werden. Die „negative Integration“ werde damit zum Geburtshelfer eines „neuen Nationalismus“, wie er hierzulande von der FPÖ gepflogen wird.
So betrachtet sollte die soziale Dimension der EU Priorität in der Präsidentschaft Österreichs haben. Realistischer Weise ist aber ein Fiasko auf den Gebiet zu befürchten.
Aus: „Die Arbeit“, 1/2006