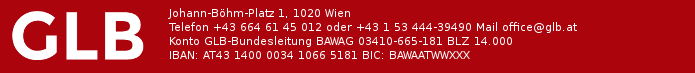0,8 Prozent der ÖsterreicherInnen besitzen 14 Prozent des Vermögens
- Freitag, 10. Juni 2005 @ 12:37
 Als alarmierend nicht nur weltweit, sondern auch für Österreich, bezeichnet der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) die wachsende Kluft zwischen enormen Reichtum auf der einen und wachsender Armut und Ausgrenzung andererseits. Laut dem jüngsten "World Wealth Report" von Capgemini und Merrill Lynch besitzen 63.000 ÖsterreicherInnen – das sind 0,8 Prozent (!) der Bevölkerung – 14 Prozent des heimischen Gesamtvermögens. Die gegenüber 2003 um rund 2.100 oder fünf Prozent gewachsene Zahl der Personen mit einem Vermögen von mehr als einer Million Dollar bzw. 0,82 Mio. Euro besitzt 144 von insgesamt rund tausend Milliarden Euro Gesamtvermögen in Österreich.
Als alarmierend nicht nur weltweit, sondern auch für Österreich, bezeichnet der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) die wachsende Kluft zwischen enormen Reichtum auf der einen und wachsender Armut und Ausgrenzung andererseits. Laut dem jüngsten "World Wealth Report" von Capgemini und Merrill Lynch besitzen 63.000 ÖsterreicherInnen – das sind 0,8 Prozent (!) der Bevölkerung – 14 Prozent des heimischen Gesamtvermögens. Die gegenüber 2003 um rund 2.100 oder fünf Prozent gewachsene Zahl der Personen mit einem Vermögen von mehr als einer Million Dollar bzw. 0,82 Mio. Euro besitzt 144 von insgesamt rund tausend Milliarden Euro Gesamtvermögen in Österreich.Wie die GLB-Bundesvorsitzende Karin Antlanger (BRV EXIT-sozial Linz) schon bei der letzten Bundeskonferenz des GLB festgestellt hat, ist zunehmend die zentrale politische Frage auch aus gewerkschaftlicher Sicht die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums: Derzeit besitzen in Österreich 90 Prozent der Bevölkerung ein Drittel des bereits rund eine Billion Euro betragenden privaten Vermögens, neun Prozent besitzen das zweite Drittel und das restliche eine Prozent das dritte Drittel.
Weltweit wuchs die Zahl der Superreichen im Jahre 2004 um weitere 600.000 auf 8,3 Millionen Personen, deren Vermögen um 8,2 Prozent auf die Summe von 30,8 Billionen US-Dollar gewachsen ist. Bezeichnend dabei ist, dass laut Reinhard Berger (Capgemini) das Vermögen dieser Personen „relativ unabhängig von der Wirtschaftslage und unabhängig von Börsenschwächen“ wachsen, was mit der Größe ihres Reichtums zusammenhängt
Wie zugespitzt die soziale Ungleichheit in manchen Regionen bereits geworden ist, wird daran deutlich, dass der Anteil der Dollar-Millionäre am Gesamtvermögen zwischen 15 und 40 (!) Prozent beträgt. Dabei ist Lateinamerika „Spitzenreiter“, wo ganze 300.000 Personen 3,7 Billionen Dollar oder zwölf Prozent des Weltvermögens besitzen. Der „Klub“ der Superreichen mit einem Vermögen von mindestens 30 Mio. Dollar ist um weitere 6.300 auf 77.500 Personen gewachsen.
Die von Capgemini angeführten Faktoren für den Wachstum des Reichtums sind eine Schande für die Steuerpolitik der österreichischen Regierungen, egal ob schwarzblau oder rotschwarz: Die Abschaffung der Vermögenssteuer und die Einführung der steuerschonenden Privatstiftungen durch den damaligen SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina gehören dazu ebenso wie die Senkung der Körperschaftssteuer durch den amtierenden Finanzminister Karl-Heinz Grasser.
Für den Gewerkschaftlichen Linksblock ist dieser Reichtumsbericht Anlass neuerlich eine grundlegende Änderung der Steuerpolitik durch wesentlich höhere Besteuerung von Kapital und Vermögen zu verlangen und damit der Ausdünnung des Sozialstaates entgegenzuwirken: „Das bedeutet die Abschaffung aller Steuerschlupflöcher und die volle Besteuerung von Gewinnen und Einkommen bis zum geltenden Höchststeuersatz“, so Antlanger abschließend.