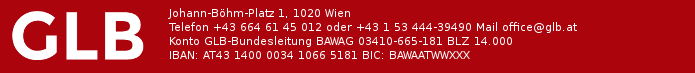Für eine zukunftsorientierte Gewerkschaftspolitik
- Samstag, 30. April 2005 @ 21:56

 von Karin Antlanger
von Karin AntlangerKolleginnen und Kollegen, auf dieser Konferenz müssen wir uns drei zentrale Fragen stellen:
1. Wie ist die Situation der Lohnabhängigen?
2. Wie ist der Zustand der Gewerkschaften?
3. Was ist die Funktion des GLB? I. Situation der Lohnabhängigen
Der Kapitalismus hat in seiner bisherigen Entwicklung verschiedene Phasen durchlaufen. Unsere Schwäche ist, dass wir dies oft nicht oder zu spät erkannt und das Entwicklungspotential des Kapitalismus unterschätzt haben, dass wir ihn durch Erkenntnisse wie jene der „allgemeinen Krise“ und eines damit angenommenen automatischen Niederganges sträflich unterschätzt haben.
Henry Ford war ein kluger Kapitalist. Er hat Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt, dass Massenkaufkraft eine Grundlage für den Profit ist, er hat erkannt, dass die Arbeiter die von ihnen hergestellten Produkte auch kaufen müssen. Die Formel „Massenproduktion braucht Massenkaufkraft“ war jahrzehntelang charakteristisch für jenen Kapitalismus, der heute als Fordismus gilt.
Nach dem 2. Weltkrieg durchlebten die avancierten kapitalistischen Staaten Westeuropas und Nordamerikas eine beispiellose Konjunkturwelle. Mit einer keynesianischen Wirtschaftspolitik gelang es, die nationale wirtschaftliche Entwicklung zu steuern und nahezu Vollbeschäftigung (zumindest für Männer) zu sichern.
Über Jahrzehnte hinweg begleitete diese Entwicklung die Arbeiterbewegung im klassischen Sinne. Massenkonsum, Sozialstaat und Verwertungsinteressen des Kapitals stimmten weitgehend überein. Sie waren Basis sowohl für einen gewissen Wohlstand der Lohnabhängigen, als auch deren Einbindung in das kapitalistische System. Anzumerken ist allerdings, dass dies global auf Kosten der Kolonien bzw. Entwicklungsländer und national auf Kosten von Frauen, MigrantInnen, Arbeitslosen und anderen Gruppen ging. Das Resultat war jedenfalls ein nordatlantischer Gürtel von Massenkonsumgesellschaften, denen es offenbar gelungen war, soziale Konflikte im Zaum zu halten.
Seit den 70er Jahren sind wir mit gravierenden Veränderungen konfrontiert, nämlich mit gravierenden technologischen Veränderungen und parallel dazu mit dem Durchbruch neoliberaler Politikkonzepte, welche die bis dahin gekannte Arbeitswelt radikal verändert haben. Die Dominanz des Dienstleistungssektors gegenüber der Produktion bedeutet freilich nicht, dass die Produktion unbedeutend wäre, nach wie vor wird dort der Mehrwert geschaffen, realisiert werden kann er aber nur im Zusammenspiel mit den anderen Sektoren. Eine Reduzierung auf die eigentliche Produktion wäre genauso ein Fehlschluss wie Negri und Hardt in ihren Theorien das Gesamtarbeitsverhältnis zugunsten einer so genannten Multitude auflösen wollen.[1]
Mit der Niederlage des Realsozialismus hat sich die neoliberale Entwicklung drastisch verschärft, wie der Umbruch seit Anfang der 90er Jahre anschaulich beweist. Damit ist nämlich ein globales Gegengewicht weggefallen, der Kapitalismus braucht nicht mehr wie jahrzehntelang zuvor Rücksicht zu nehmen und zeigt sich so wie er eigentlich immer war, als ein menschenverachtendes Gesellschaftssystem. Mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz ist auch die Beisshemmung weggefallen.
Die Konkurrenz wurde zum obersten Prinzip, auch und vor allem die Konkurrenz innerhalb der ArbeiterInnenklasse. Wir sind heute mit einer systematischen Zerstörung der Solidarität und Diffamierung derselben als veraltet und unmodern, als etwas für Schwache: „Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich“, meint etwa der Papst des Neoliberalismus, August von Hayek. Und der deutsche Wirtschaftsforscher Hans-Werner Sinn meinte gar: „Der Sozialstaat ist ein Menschen verachtendes System“[2]
Der so genannte „Normalarbeiter“ als Maßstab für Gewerkschaftspolitik wird zunehmend verabschiedet. Die Zahl der klassischen qualifizierten Industriearbeiter, ausgestattet mit Normalarbeitszeit, relativ gutem Verdienst, sicherem Arbeitsplatz und sozial abgesichert wird immer weniger. Das Modell „Normalarbeiter“ war freilich schon in der Vergangenheit schieflastig. Es galt faktisch nur für Männer. Was war mit den Frauen, was mit den Migranten? Damit haben auch wir uns oft nicht genügend auseinandergesetzt, Gleichberechtigung wurde vielfach auf eine ferne Zukunft verschoben.
Charakteristisch für immer mehr Lohnabhängige ist heute eine umfassende Prekarisierung und diese hat viele Aspekte: Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit, Arbeit auf Abruf, freie Dienstnehmer, aber auch die Debatte um die Ausdehnung der Arbeitszeit und die Abschaffung der Überstundenzuschläge sind Teil dieser Prekarisierung. Mittlerweile sind über eine Million Menschen in Österreich in atypischen Verhältnissen beschäftigt. In EU-Ländern wie den Niederlanden oder Dänemark gilt heute schon die Prekarisierung als „normal“ und auch Österreich ist auf dem besten Weg dahin.
Die Wirkung der Prekarisierung geht aber weit über Arbeitswelt hinaus auf die gesamte Gesellschaft – umfasst Bildung und Kultur genauso wie Wohnen und Familienleben. Umfassende Prekarisierung ist dem neoliberalen Kapitalismus systemimmanent und wird gleichzeitig durch das Dogma TINA „there ist no alternative“ in den Köpfen der Menschen mehrheitsfähig gemacht.
Der Maßstab einer Interessenpolitik für Lohnabhängige hat sich verschoben, dem muss Rechnung getragen werden. Wir werden die Fragen der Zukunft nicht mit Rezepten der Vergangenheit oder gar einer Rückkehr in diese beantworten können.
Die Gesellschaft ist bedingt durch die enorme Produktivität heute reicher denn je. Das uns immer wieder von Politik und Wirtschaft, Medien und „Experten“ entgegengehaltene Argument, soziale Sicherheit sei nicht mehr finanzierbar wird durch einen Blick auf die Fakten laufend widerlegt:
Das Geld ist vorhanden:
- Rund 55 Mrd. € liegen steuerfrei auf rund 2.500 Privatstiftungen der Reichen und Superreichen, darunter auch aktive und ehemalige Politiker wie Bartenstein, Prinzhorn und Androsch.
- Über 7 Mrd. € machen die Rückstände der Unternehmer bei Finanzämtern und Sozialversicherungen aus.
- An die 6 Mrd. € beträgt die jährliche Steuerhinterziehung.
- Die ersatzlose Streichung der Vermögenssteuer 1994 brachte den Unternehmern bisher 5,8 Mrd. €.
- Die Abschaffung der Sonderabgabe für Banken 1994 brachte den Banken bereits 145,3 Mio. €.
- Die Abschaffung der Gewerbesteuer (nur zur Hälfte durch die Kommunalabgabe kompensiert) brachte seit 1994 den Unternehmen in Summe 5,2 Mrd. €,
- Die Senkung der Körperschaftssteuer von 34 auf 25 Prozent bedeutet ein Steuergeschenk von 1,1 Mrd. € an die Kapitalgesellschaften
Für die Finanzierung der Pensionen nach dem bewährten Umlageverfahren ist nicht die Alterspyramide entscheidend, sondern die Wertschöpfung. Wie die großbürgerliche „Presse“[3] vorgerechnet hat, entsprechen 100 € vor 40 Jahren nach der Inflationsentwicklung heute 500 €, nach dem Wirtschaftswachstum aber 1.800 €! Wenn die bisher nur nach der Lohnsumme bemessenen Unternehmerbeiträge zur Sozialversicherung auf die gesamte Wertschöpfung umgestellt werden um der immensen Rationalisierung Rechnung zu tragen, dann sind Pensionen, Gesundheit etc. auch künftig finanzierbar: „Die Diskussion über die Rente ist nichts anderes als der gigantische Versuch der Lebensversicherungen an das Geld der Leute heranzukommen“, der das sagte war Heiner Geißler, ehemaliger Generalsekretär der CDU.
Die zentrale Frage ist daher die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Derzeit besitzen in Österreich 90 Prozent der Bevölkerung ein Drittel des bereits rund eine Billion Euro betragenden privaten Vermögens, neun Prozent besitzen das zweite Drittel und das restliche eine Prozent, darunter die 66.000 Euro-Millionäre, das dritte Drittel. Daher gilt es Kernfragen wie Lohnpolitik, Steuerpolitik, Sozialpolitik und öffentliches Eigentum immer wieder neu aufs Tapet zu bringen. Die Gewerkschaften brauchen ein Alternativprogramm mit folgenden Kernpunkten:
- Arbeitszeit verkürzen statt verlängern
- Erhalt und Ausbau des öffentlichen Sektors
- Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums
- offensive Beschäftigungspolitik mit öffentlichen Aufträgen und Stärkung der Kaufkraft
- Erhalt und Ausbau des Sozialstaates
- demokratische Kontrolle der Wirtschaft
II. Zustand der Gewerkschaften
Die Krise der Gewerkschaften ist international. Vor allem wird sie in Mitteleuropa deutlich, wo die sozialpartnerschaftliche Ausprägung wie in Österreich oder Deutschland am stärksten ist. Auffällig ist das Zusammentreffen des Beginns der ökonomischen Globalisierung einerseits und der Talfahrt der Gewerkschaften andererseits, der erkämpfte Sozialstaatskompromiss verliert seine Grundlage. Trotzdem stützen sich die Gewerkschaften weiter in der institutionellen Einbindung ab und werden damit indirekt zum Co-Manager des Sozialabbaus, egal ob unter rotgrün in Deutschland oder unter schwarzblau in Österreich.
Notwendig ist es aber, sich als Gewerkschaften politisch neu, nämlich autonom und radikal interessenbezogen zu formieren und sich langfristig, aber grundlegend neu zu strukturieren. Jahrzehnte sozialpartnerschaftlicher Politik und Kooperationspolitik haben tiefe Spuren im Bewusstsein der Betriebsräte sowie der gewerkschaftlichen FunktionärInnen auf allen Ebenen hinterlassen. Obwohl das Kapital und die politischen Eliten Kooperation und Sozialpartnerschaft schon seit über 15 Jahren aufgekündigt haben, halten Gewerkschaftsspitzen eisern daran fest. Die Tiefe der Kapitaloffensive ist in weiten Teilen der Gewerkschaften noch immer nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisiert worden.[4]
Der ÖGB ist bekanntlich traditionell regierungsorientiert, jahrzehntelang wurden die Sozialminister vom ÖGB gestellt. Als Reaktion auf den Schock des Oktoberstreiks von 1950 sowohl für das Kapital als auch die ÖGB-Spitzen hat sich eine Parallelregierung in Form der Sozialpartnerschaft etabliert, von Bruno Kreisky treffend als „sublimierter Klassenkampf“ bezeichnend. Die Basis dafür war ein enormer Wirtschaftsaufschwung ab Mitte der 50er Jahre. Den damit verbundenen großen Verteilungsspielraum und die Auswirkungen auf das Bewusstsein haben wir vielfach unterschätzt.
Eine Änderung der Situation trat in den 80er Jahren ein. Der Verteilungsspielraum wurde enger, damit verbunden war der Aufschwung der FPÖ als Protestreaktion darauf. Gerade viele Arbeiter strömten in Scharen zu Haider, der ihre Erwartungshaltung mit klassisch populistischen Versprechungen schürte. Noch schneller war allerdings der Rückstrom zur SPÖ nach der „Wende“ im Jahre 2000, als die angesichts der FPÖ-Regierungspraxis vermeintlich Betrogenen ihrer Enttäuschung Luft machten.
Der Hintergrund dafür ist die Entpolitisierung der ArbeiterInnenklasse durch eine klassische Stellvertreterpolitik. Mit der Faustregel „Die SPÖ sorgt für Arbeit, Wohnung und Karriere etc., wähle die SPÖ, aber sei ansonsten ruhig“ wurde jahrzehntelang jede Eigentätigkeit unterbunden und damit auch linke Politik gezielt diffamiert, gleichzeitig aber die Schleusen nach rechts weit offen gehalten.
Bezeichnend ist die Reaktion des ÖGB auf den Regierungswechsel im Jahre 2000. Der „Riese“ ÖGB war monatelang völlig orientierungslos, er hat die breite Protestbewegung gegen schwarzblau enttäuscht und in Stich gelassen. Erst als Sallmutter demontiert wurde, ist auch der ÖGB aufgewacht. Sein Maßstab war offensichtlich nicht so sehr die Betroffenheit der Lohnabhängigen im Allgemeinen, sondern des eigenen Apparats.
Die ÖGB-Urabstimmung im Herbst 2001 war ein wichtiges Signal, sie zeigte Bereitschaft zum aktiven Widerstand. Die Nagelprobe dafür war das Streik- und Protestjahr 2003 als größter Protest seit 1950. Während zigtausende Lohnabhängige bereit waren, sich gegen den Sozialabbau zu engagieren, würgte die ÖGB-Spitze den Streik rasch ab und verlagerte die Auseinandersetzung ins Parlament, womit dem Widerstand die Spitze gebrochen wurde. Das in Folge vorgelegte ÖGB-Pensionskonzept war faktisch ein Spiegelbild des Regierungskonzepts und nicht eine Alternative dazu. Ähnlich agierte der ÖGB beim AUA-Streik und beim ÖBB-Streik als ein der Standortpolitik des Kapitals verpflichteter Ordnungsfaktor.
Wir dürfen nicht vergessen, immer wieder daran zu erinnern, dass die Linie von Sozialabbau und Privatisierung nicht erst seit Februar 2000 gefahren wird, sondern wesentliche Maßnahmen schon vorher durch die 1986 angetretene rotschwarze Regierung als Vorleistungen und Auswirkungen des EU-Beitritt erfolgten. Ex-Verstaatlichtenminister Rudolf Streicher hat mit der Aussage „Unser Katechismus ist das Aktienrecht“[5] die Privatisierungspolitik der SPÖ auf den Punkt gebracht. Parteichef Gusenbauer hat sie mit der Feststellung „es wird keine Privatisierung rückgängig gemacht“[6] sinnvoll ergänzt.
Die Entwicklung in Österreich kann nur im Kontext mit der internationalen, insbesondere der EU-Entwicklung gesehen werden. Daher wird eine internationale Orientierung immer wichtiger, wobei klar sein muss, dass der Kampf immer im eigenen Land beginnt. Der ÖGB gebraucht das Argument der Internationalisierung meistens nämlich nur als Ausrede für Untätigkeit hier und jetzt. (19.März 05)
Die SPÖ ist keine wirkliche Alternative zu ÖVP, weil sie die neoliberale Politik ebenso voll verinnerlicht hat wie alle Parlamentsparteien. Ein Blick über die Grenzen beweist: Rotgrün in Deutschland praktiziert die gleiche Politik „sozialer Kälte“ wie schwarzorange in Österreich. In England hat New Labour die Liberalen bereits rechts überholt. Es geht also um eine andere Politik. Es geht darum, dass sich die Gewerkschaften aus der Umklammerung der Parteien lösen, auf Österreich bezogen gilt das vor allem auf das Verhältnis des ÖGB zur SPÖ.
Die krampfhaften Versuche einer demonstrativen Wiederbelebung der Sozialpartnerschaft über die Achse Leitl-Verzetnitsch und die Bestrebungen der ÖGB-Spitze die Sozialpartnerschaft sogar nach Brüssel zu exportieren sind völlig falsche Rezepte. Befreit von hohlen Phrasen wie „Wir sind Europa“ bleibt die nackte Wahrheit als Unterwerfung unter die Standortpolitik des Kapitals. Solange die Orientierung des ÖGB vorrangig darauf zielt, die SPÖ wieder in die Regierung zu bringen wird es wenig Fortschritt für die Lohnabhängigen geben. Die Lohnabhängigen brauchen keine EU-konforme Sanierungspolitik mit dem ÖGB als Ordnungsfaktor, sondern neue Strategien.
Anstelle der korporatistischen Einbindung müssen horizontale Bündnisse mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und sozialen Bewegungen treten. Globalisierung bedeutet ja nicht einfach den Exodus des Kapitals in Niedriglohnländer, sondern die Zunahme der internationalen Arbeitsteilung und Herausbildung eines internationalen Arbeitsmarktes, wie das Marx und Engels bereits im „Kommunistischen Manifest“ von 1847 angedacht haben.
Es ist die falsche Reaktion der Gewerkschaften, wenn sie statt auf multinationale Branchengewerkschaften auf nationale Multibranchengewerkschaften wie am Beispiel verd.i in Deutschland oder G4/5 in Österreich setzen. Die Gewerkschaften müssen sich frei nach Engels „entlang des ganzen Gewerbes“ neuen ökonomischen Realitäten folgend entlang der Wirtschafts- und Branchengrenzen, die sich um nationalstaatliche Grenzen immer weniger scheren, formieren.
Ein Maßstab dafür sind Erfahrungen anderer Länder:
- In den USA waren die Gewerkschaften in den 80ern bereits totgesagt, sie erlebten einen neuen Aufschwung durch Umorientierung auf die Förderung Basisaktivitäten statt Stellvertreterpolitik und gaben mit einigen erfolgreichen Streiks wieder kräftige Lebenszeichen.
- Das Beispiel der Internationalen Hafenarbeitergewerkschaft zeigt eine erfolgreiche Strategie gegen die Internationalisierung des Kapitals
- Auch die massiven Protestaktionen in den traditionell weniger sozialpartnerschaftlich deformierten europäischen Südländer wie Italien, Griechenland, Spanien etc. leben eine andere Gewerkschaftskultur vor.
- Als Resümee lässt sich festhalten: Nicht eine europäische Sozialpartnerschaft von der Verzetnitsch träumt, sondern europäischer Widerstand und Klassenkampf sind notwendig.
Einige recht aufschlussreiche Feststellungen der Sachbuchautorin Christine Bauer-Jelinek (Coach) müssen sich die Gewerkschaften ins Stammbuch schreiben. Sie stellt unter anderem fest „In der Wirtschaft herrscht Krieg“, der „Neoliberalismus pflegt Gewinnmaximierung als höchstes Gut und ist bereit, dieses Ziel auch mit Gewalt durchzusetzen“ und schlussfolgert „Man müsste die Waffen des Gegners studieren und lernen, sie erfolgreich einzusetzen“.
Was sind die sensiblen Bereiche, die Schwachstellen des heutigen Kapitalismus? Das sind
- der Finanzsektor, also Banken, Versicherungen, Börsen usw.
- die Energieversorgung, denn ohne Energie läuft nichts,
- die Informations- und Kommunikationsstruktur wie Post- und Telekom, Internet etc. und
- die Transportnetze auf Straßen, Schienen, Wasser oder in der Luft
Störungen dieser sensiblen Bereiche können die Funktionsweise eines zunehmend global agierenden Systems gehörig ins Wanken bringen, es sei nur daran erinnert, wie nervös man in den Voest-Vorstandsetagen nach zwei Tagen ÖBB-Streik bereits geworden ist.
„Eine klarere Position zum herrschenden Wirtschaftssystem ist nötig, sonst wirken alle Maßnahmen nur wie Kosmetik auf Pestbeulen“, die Gewerkschaft muss sich zu einer „rebellischen Kraft für tatsächliche Veränderungen entwickeln“, der ÖGB muss „neue Allianzen bilden und alternative Gesellschaftsmodelle entwickeln“, es ist zu wünsche, dass ein „Wandel des ÖGB von einer staatstragenden zu einer gesellschaftsverändernden Kraft“ gelingt[7]. Soweit Christine Bauer Jelinek - dem ist wenig hinzuzufügen.
III. Funktion des GLB
Vor 60 Jahren, am 13. April 1945, erfolgte die Gründung des ÖGB durch Vertreter von SPÖ, KPÖ und ÖVP. Wenn die ÖGB-Story heute als eine einzige „Erfolgsgeschichte“ dargestellt wird, dann obliegt es uns als GLB dazu die notwendigen kritischen Anmerkungen zu machen. Ein überparteilicher Gewerkschaftsbund bedeutete zweifellos einen Fortschritt gegenüber der 1. Republik und war auch logische Konsequenz aus den bitteren Erfahrungen des Widerstandes gegen den Faschismus der auch zwölf Jahre ohne legale Gewerkschaften bedeutet hatte.
Der Machtanspruch der SPÖ führte freilich sehr rasch zur Fraktionierung des ÖGB. Die Gewerkschaftliche Einheit und später der Gewerkschaftliche Linksblock setzten im Unterschied zu anderen Fraktionen jedoch immer auf einen breiten Zugang, unser Kriterium sind ausschließlich die Interessen der Lohnabhängigen für eine von Kapital und Regierung unabhängige, kämpferische Gewerkschaftspolitik. Ob uns auch die Aktivierung möglichst vieler Lohnabhängiger statt Stellvertreterpolitik und die Förderung von Selbsttätigkeit im notwendigen Ausmaß gelang und in Zukunft gelingen wird, steht auf einem anderen Papier. Gerade in der Breite und Vielfalt liegt aber auf jeden Fall eine Menge Potential und Stärke des GLB, mit einer Verengung würden wir hingegen nur über die eigenen Beine stolpern.
Zwei wichtige Punkte sind für unser Selbstverständnis freilich auch anzumerken:
- Ad eins. Der Kampf für Frauenrechte kann für uns keine Nebenfrage sein, deren Lösung auf eine ferne Zukunft vertagt werden kann, die Gleichberechtigung muss hier und jetzt angegangen werden.
- Ad zwei. Die ArbeiterInnenklasse ist multiethnisch und multinational, daher kann der GLB keine Zugeständnisse an Diskriminierung und Rassismus jeder Art machen, es sei hier an die Feststellung von Karl Marx „die Arbeiter haben kein Vaterland“ erinnert und diese gilt mehr denn je.
Im „Manifest“ definierten Marx und Engels die Rolle der Arbeiterklasse als "die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl". Das Problem ist, dass diese ArbeiterInnenklasse heute differenzierter denn je ist. Objektiv wären die Verhältnisse längst reif für eine andere, sozialere, gerechtere Gesellschaft, der subjektive Faktor aber ist weiter denn je davon entfernt diese Gesellschaft herbeizuführen. Mit diesem Widerspruch müssen wir umgehen lernen. Vor allem dürfen wir auch nicht die desaströsen Auswirkungen unterschätzen, die sich daraus ergeben, dass heute zunehmend auch Arbeiter mit Aktien spekulieren, dass sie mit betriebsrätlicher Zustimmung über Mitarbeiterbeteiligungen - verbunden mit Lohnverzicht - Miteigentümer werden oder auf eine Altersvorsorge über Pensionsfonds hoffen. Überall steht hinter der Erwartung einer möglichst hohen Rendite der Druck auf Arbeitsplätze, Löhne und Sozialleistungen der betroffenen Beschäftigten. Denn das Geld muss letztlich irgendwo erwirtschaftet werden, es bildet sich nicht im luftleeren Raum.
Es ist leicht Beifall zu erhalten, wenn in Arbeiterkammern oder Gewerkschaftsgremien Kritik an der Regierungspolitik von schwarz-blau geübt wird. Die Messlatte für den GLB ist aber nach wie vor die Auseinandersetzung mit der FSG-Mehrheit. Es muss uns darum gehen, Widersprüche zwischen Sonntagsreden und Verbalradikalismus der FSG auf der einen Seite und realer Politik der Sozialdemokratie in Österreich und EU-weit deutlich machen.
Es muss auch darum gehen, unsere Positionierungen in Gewerkschaftsgremien deutlich zu machen, wenn notwendig auch dagegen zu stimmen, etwa bei KV-Abschlüssen oder Grundsatzentscheidungen. (Keine Angst vor Totschlagargumenten wie „wollt ihr verhindern, dass die Leute wenigstens 1,7 % bekommen etc.) Es geht dabei auch darum, dass wir eine Orientierung auch für kritische GewerkschafterInnen anderer Fraktionen, wie uns immer wieder bestätigt wird, geben können. Es kommt darauf an, die brisanten Fragestellungen zu finden und davon ausgehend die richtigen Aktionen zu setzen.
Dabei waren wir in den letzten Jahren in einigen Fragen durchaus erfolgreich:
- So gelang es uns unter dem Slogan „Lohnnebenkosten sind Sozialleistungen“ den ÖGB in dieser wichtigen Frage munter zu machen.
- Im Rahmen der Pensionsdebatte 2003 konnten wir schwerpunktmäßig die Forderung nach einer Wertschöpfungsabgabe thematisieren.
- Bei der Debatte um die EU-Dienstleistungsrichtlinie haben wir mit dem Zusammenhang mit der EU-Verfassung manche ÖGB-Granden nervös gemacht.
- Frühzeitig haben wir die Forderung nach einer Volksabstimmung über die EU-Verfassung erhoben. ÖGB-Präsident Verzetnitsch hatte sich im Oktober 2004 mit der Forderung nach einer Volksabstimmung zu weit aus dem Fenster gelehnt, wir sorgen dafür, dass sein Rückzieher nicht vergessen wird.
- Im Sozialbereich gelang es mit der Kritik am BAGS-KV, im Zusammenhang mit einer SozialarbeiterInnen-Demo 2003 in Linz und der Plattform Soziales Wien Akzente zu setzen.
- Im Kampf gegen die Liberalisierung, Ausgliederung und Privatisierung des öffentlichen Eigentums sind vor allem die Aktivitäten im Bereich des Wiener Magistrats, der Post und der ÖBB zu erwähnen.
Ein entscheidender Faktor ist unsere Präsenz in den Betrieben. Ein Vergleich der Situation heute mit jener vor zehn oder zwanzig Jahren zeigt gravierende Veränderungen. Nur in wenigen der einstigen „Hochburgen“ konnte sich der GLB durchgehend behaupten. Der Verlust zahlreicher einst wichtiger Positionen hat viele Gründe, subjektive weil es nicht gelang, rechtzeitig die nötige personelle Breite zu entwickeln und NachfolgerInnen für ausscheidende MandatarInnen aufzubauen. Aber auch viele objektive, beginnend vom massiven parteipolitischen Druck der FSG auf kritische GewerkschafterInnen und vor allem auch den Wandel in Richtung Dienstleistung und die Veränderung der Arbeitsverhältnisse. Und natürlich haben die traditionellen Großbetriebe weiterhin ihre Bedeutung, nicht vergessen werden darf aber, dass es auch zunehmend Großbetriebe mit tausenden Beschäftigten im Dienstleistungssektor gibt. Dies findet in den Köpfen so mancher GLBlerInnen noch zu wenig Beachtung.
Heute haben wir unsere wichtigsten Positionen abgesehen von ÖBB und Gemeindebediensteten bei den Angestellten. Es ist keineswegs so, dass automatisch alle SozialarbeiterInnen eine Grünpräferenz haben, im Gegenteil – hier gibt es große Chancen unsere Präsenz auszubauen. Und das gilt auch für andere Branchen wie etwa die Kulturarbeit, den IT-Sektor, den Gesundheitsbereich usw. Es geht dabei um einen langfristigen und gezielten Aufbau von Positionen, auch und gerade durch BetriebsrätInnen. Es gibt aber gerade in den vielen kleinen und mittleren Betrieben, wo der Einfluss der FSG oder FCG weniger Rolle spielt und es besonders auf die Personen ankommt viele Möglichkeiten Fuß zu fassen. Auch soll die Möglichkeit, aus dem Kreis der vielen nicht fraktionell deklarierten BetriebsrätInnen MitstreiterInnen für den GLB zu gewinnen genützt werden.
Der GLB ist eine kleine Fraktion und wir müssen uns immer dessen bewusst sein. Vergleicht man unsere Präsenz bei den großen Demonstrationen und Kundgebungen der letzten Jahre mit der Rolle in den Gewerkschaften, dann wird deutlich, dass unser politischer Einfluss weit größer ist als die zahlenmäßige Stärke. Es geht darum, unsere Funktion im ÖGB möglichst exakt zu definieren. Wir können keine Bäume ausreißen, aber sehr wohl die Rolle als ein kritisches Ferment erfüllen, als Salz in den Wunden des ÖGB. Dabei ist der GLB auch offen für die Zusammenarbeit mit allen anderen kritischen Gruppen im ÖGB, die einer fortschrittlichen Gewerkschaftspolitik dienen, etwa durch die Bildung von Plattformen und Kooperationen wie im Zusammenhang mit dem letzten ÖGB-Kongress.
Der Funktion des GLB – ein kritisches Korrektiv innerhalb der Gewerkschaften zu sein – können wir aber nur dann gerecht werden, wenn wir uns nicht in innerfraktionellen Machtkämpfen selbst zerfleischen, sondern durch gemeinsame konstruktive inhaltliche Weiterentwicklung – und diese soll durchaus anhand kontroversieller Diskussionen geschehen – auf unser Kerngeschäft orientieren: nämlich die konsequente Interessenvertretung der Lohnabhängigen im weitesten Sinne unter Einbeziehung derselben.
Der GLB war immer als ein breites Bündnis angelegt – was wir nicht brauchen können, sind parteipolitisch motivierte Grabenkämpfe. Uns muss klar sein, dass auch in Hinkunft ein guter Teil der GLB-Mitglieder parteilos sein wird oder auch in einer anderen Partei organisiert sein wird als der KPÖ. Gleichzeitig werden wir auch in Hinkunft ein solidarisches Verhältnis zur KPÖ pflegen, die ja auch eine der drei Gründungsparteien des ÖGB ist. Solidarisches Verhältnis und kritische Auseinandersetzung sind dabei keine Antagonisten, widersprechen einander nicht.
Zuletzt noch ein paar persönliche Worte:
Mir wurde, seit bekannt ist, dass ich für den GLB-Vorsitz und das ÖGB-Bundesvorstandsmandat kandidiere, von meinen KritikerInnen nachgesagt, dass ich polarisiere – und das sei nicht gut.
Es gibt Situationen und Zusammenhänge, in denen es gut ist, möglichst viele Meinungen zu integrieren und Kompromisse zu schließen. Ich denke, der Wahlvorschlag der Bundesleitung z.B. ist ein solcher guter Kompromiss. Er berücksichtigt alle Gewerkschaften, in denen wir namhafte Positionen haben. Weiters berücksichtigt er die Streuung über die Bundesländer sowie einigermaßen den Frauenanteil im GLB. Wichtig ist, dass wir auf keine der im GLB vertretenen Gewerkschaften verzichten können oder wollen. Ich bedaure es daher umso mehr, dass die Metaller heute eher gering vertreten sind auf dieser Konferenz. Ich denke, dass der Wahlvorschlag der Bundesleitung sehr sorgsam darauf bedacht genommen hat, dass die neue Bundesleitung ein arbeitsfähiges Gremium wird.
Aber zurück zur Frage der Polarisierung: Es gibt Situationen, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, z.B. wenn die Frage steht, stimme ich dem KV-Abschluss zu oder nicht. Diese Fragestellung polarisiert und ich hoffe, dass ihr alle, wie ihr hier versammelt seid, polarisieren könnt, wenn Entscheidungen anstehen. Auch und gerade in der Auseinandersetzung mit den anderen Fraktionen im ÖGB ist es für Linke hilfreich, wenn wir als GLB eine gewisse Polarisierung vorantreiben – denn die integrierende Sozialpartnerschaft mit der „Wir sitzen alle im selben Boot – Ideologie“ hat die Gewerkschaften genau dorthin gebracht, wo sie heute stehen.
Also: mehr Mut zum Polarisieren. Schwierige Zeiten erfordern eindeutige Entscheidungen und man kann nicht immer jedem nach dem Mund reden. Wir müssen aber auch wissen, wo und in welcher Frage wir zuspitzen, wo wir den Keil hineintreiben wollen. Und da stehen wir vor dem Problem, dass manche aus unseren Reihen dies halt innerhalb des GLB machen wollen, innerhalb unserer Organisation polarisieren und das Ganze zum Kippen bringen wollen.
In letzter Zeit hab ich es wiederholt erlebt, dass gerade aus kritischen SP-Kreisen immer wieder mal artikuliert wird: „Die Zeiten waren schon lang nicht mehr so gut für wirklich linke Positionen, eigentlich müsstet ihr als GLB jetzt den totalen Aufschwung haben, woran scheitert das….“ Dafür gibt es natürlich verschiedenste Gründe – aber die GLB-internen personellen und strukturellen Querschüsse, die noch dazu fernab einer inhaltlichen Auseinandersetzung ablaufen (positive Ausnahme war BR-Konferenz und letzte Bundesleitung) sind sicherlich einem Aufschwung des GLB abträglich. Würde nur die Hälfte der Energie, die dafür verwendet wird, in inhaltliche Arbeit investiert werden – wir stünden bald um einiges besser dar.
Drum KollegInnen: wir müssen nicht immer alle einer Meinung sein, wir müssen uns ja nicht alle gegenseitig heiraten und lieben – aber wir können doch miteinander gute Gewerkschaftsarbeit machen und dort wo es nötig ist, auch konstruktiv miteinander streiten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen nach der Mittagspause eine produktive - und dort wo nötig – kontroversielle Diskussion.
Referat von Karin Antlanger bei der 13. GLB-Bundeskonferenz am 30. April 2005 in Wien. Es gilt das gesprochene Wort.
[1] Bischoff Joachim/Lieber Christoph/Sandleben Guenther (2004): Klassenformation Multitude?, Kritik der Zeitdiagnose von Antonio Negri und Michael Hardt, Supplement der Zeitschrift Sozialismus, 12/2004
[2] Leitantrag anm die Bildungskonferenz des ÖGB-OÖ, 22. April 2005
[3] „Die Presse“, 22. März 2003
[4] Riexinger Bernd/Sauerborn Werner (2004): Gewerkschaften in der Globalisierungsfalle, Supplement der Zeitschrift Sozialismus, 10/2004
[5] „Arbeit & Wirtschaft“, Nummer 9/2000
[6] „Neue Zürcher Zeitung“, 25. September 2002
[7] Bauer-Jelinek Elfriede (2005): Neue Machtverhältnisse brauchen neue Durchsetzungsstrategien, „OÖ Nachrichten“-Beilage ÖGB, 16. April 2005, S. 6